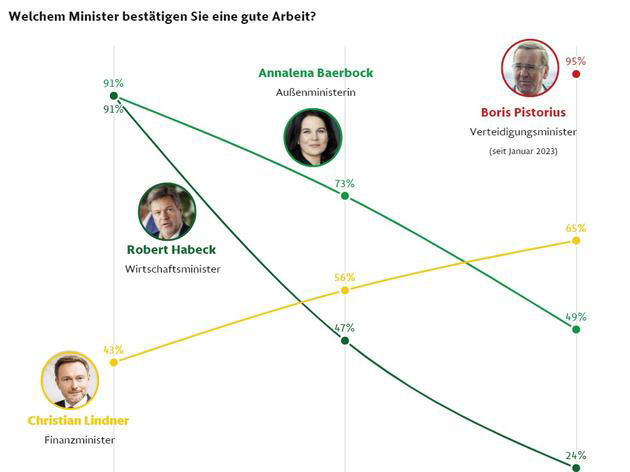Forum
News zur Bundesregierung
Zitat von Gast am 13. Juli 2023, 08:00 UhrCDU-Rebell: "Das lasse ich mir nicht gefallen"
Heizungsgesetz bei "Lanz"
CDU-Rebell: "Das lasse ich mir nicht gefallen"
Droht der Ampel gleich die zweite Verfassungsklage beim Heizungsgesetz? Die Regierung missachte den Gerichtsbeschluss, kritisierte Kläger Thomas Heilmann bei "Lanz".
Die Bundesregierung hat laut Thomas Heilmann nichts aus seiner erfolgreichen Verfassungsklage gegen die Abstimmung zum Heizungsgesetz gelernt. Das könnte laut dem CDU-Bundestagsabgeordneten einen erneuten Gang nach Karlsruhe rechtfertigen. "Das Bundesverfassungsgericht hat Beratungszeit angeordnet", sagte der ehemalige Berliner Justizsenator am Mittwochabend bei "Markus Lanz". "Dazu ist die Ampel offensichtlich noch nicht bereit, was ich für einen erneuten Verfassungsverstoß halte."
Die Gäste
・Thomas Heilmann (CDU), kippte Heizungsgesetz-Abstimmung
・Claudia Major, Sicherheitsexpertin・Robin Alexander, "Welt"-Journalist
Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte kürzlich bei "Lanz" den Eindruck erweckt, die Opposition habe durch die gestoppte Abstimmung lediglich mehr Zeit bekommen, den Gesetzentwurf noch mal in Ruhe zu lesen. Hier gehe es aber nicht schlicht um einen neuen "Notartermin", betonte Heilmann. "Sie haben klar gesagt: Das lassen wir so", gab Lanz die Haltung der Regierung wider. "Das ist eine Missachtung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes", unterstrich der Christdemokrat.
Für ihn sind bei dem Heizungsgesetz noch so viele Fragen offen, dass er damit eine ganze Sendung füllen könnte, etwa zur Förderung der Wärmepumpen. "Mir missfällt schon seit langem, auch schon in der Merkel-Zeit, dass der Bundestag immer kürzer über die Dinge berät. Dabei entstehen viele handwerkliche Fehler", kritisierte Heilmann.
Kläger bei Lanz: "Wir kriegen sie schon dazu"
Konkrete Pläne für eine erneute Klage schmiedet er angeblich derzeit nicht. "Soweit bin ich noch lange nicht", meinte der Abgeordnete. "Sie denken drüber nach?", fragte Lanz. "Nein, ich denke darüber nach, der Bundestagspräsidentin einen Brief zu schreiben", erwiderte Heilmann. Er gab sich aber siegesgewiss: "Wir kriegen sie schon dazu, das zu beraten."
Den Rest von Habecks Soloauftritt bei "Lanz" fand der Heizungsgesetz-Stopper übrigens gelungen: "Er war für einen Politiker erstaunlich selbstkritisch und das hat mir gefallen." Weniger positiv fiel für ihn die Reaktion des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr aus. Der hatte auf Heilmanns Frage im Bundestag, wann die Abgeordneten denn mit dem Gesetzentwurf rechnen könnten, mit einer Tirade gegen die Klimapolitik der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) geantwortet. (Dürr ist übrigens am Donnerstag zu Gast in der letzten "Lanz"-Sendung vor der Sommerpause.)
"Das ist eine so polemische Antwort gewesen", sagte Heilmann. "Da habe ich gesagt: Das ist eine derartige Arroganz der Macht, das lasse ich mir nicht gefallen." Am Tag darauf habe er angefangen, die Klageschrift für Karlsruhe zu verfassen. Der Vorsitzende der KlimaUnion attestierte der Ampelkoalition eine "katastrophal" falsche Strategie für den Klimaschutz und eine "Wir wissen alles besser"-Haltung. "Die Dämmung ist wichtiger als die Heizung", betonte der Unternehmer, der nach eigenen Angaben von 2007 bis 2010 Kleingesellschafter bei Facebook sowie Mitgründer von Xing und MyToys war.
Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander attestierte der Bundesregierung beim Heizungsgesetz eine "Trotzreaktion". "Ich glaube, damit kommen sie nicht durch", erwartete er. Für die Ampel stehe aber bei dem "Formelkompromiss" viel auf dem Spiel. Allein dafür seien x-Anläufe nötig gewesen. "Die fragen sich, ob sie noch einen hinkriegen", mutmaßte Alexander. Eine Niederlage bei diesem Teil der Wärmewende hätte massive Auswirkungen. "Wenn das nicht klappt, hat man dem Klimaschutz in D echt einen Schlag versetzt", warnte Alexander.
CDU-Rebell: "Das lasse ich mir nicht gefallen"
Heizungsgesetz bei "Lanz"
CDU-Rebell: "Das lasse ich mir nicht gefallen"
Droht der Ampel gleich die zweite Verfassungsklage beim Heizungsgesetz? Die Regierung missachte den Gerichtsbeschluss, kritisierte Kläger Thomas Heilmann bei "Lanz".
Die Bundesregierung hat laut Thomas Heilmann nichts aus seiner erfolgreichen Verfassungsklage gegen die Abstimmung zum Heizungsgesetz gelernt. Das könnte laut dem CDU-Bundestagsabgeordneten einen erneuten Gang nach Karlsruhe rechtfertigen. "Das Bundesverfassungsgericht hat Beratungszeit angeordnet", sagte der ehemalige Berliner Justizsenator am Mittwochabend bei "Markus Lanz". "Dazu ist die Ampel offensichtlich noch nicht bereit, was ich für einen erneuten Verfassungsverstoß halte."
Die Gäste
・Thomas Heilmann (CDU), kippte Heizungsgesetz-Abstimmung
・Robin Alexander, "Welt"-Journalist
Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte kürzlich bei "Lanz" den Eindruck erweckt, die Opposition habe durch die gestoppte Abstimmung lediglich mehr Zeit bekommen, den Gesetzentwurf noch mal in Ruhe zu lesen. Hier gehe es aber nicht schlicht um einen neuen "Notartermin", betonte Heilmann. "Sie haben klar gesagt: Das lassen wir so", gab Lanz die Haltung der Regierung wider. "Das ist eine Missachtung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes", unterstrich der Christdemokrat.
Für ihn sind bei dem Heizungsgesetz noch so viele Fragen offen, dass er damit eine ganze Sendung füllen könnte, etwa zur Förderung der Wärmepumpen. "Mir missfällt schon seit langem, auch schon in der Merkel-Zeit, dass der Bundestag immer kürzer über die Dinge berät. Dabei entstehen viele handwerkliche Fehler", kritisierte Heilmann.
Kläger bei Lanz: "Wir kriegen sie schon dazu"
Konkrete Pläne für eine erneute Klage schmiedet er angeblich derzeit nicht. "Soweit bin ich noch lange nicht", meinte der Abgeordnete. "Sie denken drüber nach?", fragte Lanz. "Nein, ich denke darüber nach, der Bundestagspräsidentin einen Brief zu schreiben", erwiderte Heilmann. Er gab sich aber siegesgewiss: "Wir kriegen sie schon dazu, das zu beraten."
Den Rest von Habecks Soloauftritt bei "Lanz" fand der Heizungsgesetz-Stopper übrigens gelungen: "Er war für einen Politiker erstaunlich selbstkritisch und das hat mir gefallen." Weniger positiv fiel für ihn die Reaktion des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr aus. Der hatte auf Heilmanns Frage im Bundestag, wann die Abgeordneten denn mit dem Gesetzentwurf rechnen könnten, mit einer Tirade gegen die Klimapolitik der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) geantwortet. (Dürr ist übrigens am Donnerstag zu Gast in der letzten "Lanz"-Sendung vor der Sommerpause.)
"Das ist eine so polemische Antwort gewesen", sagte Heilmann. "Da habe ich gesagt: Das ist eine derartige Arroganz der Macht, das lasse ich mir nicht gefallen." Am Tag darauf habe er angefangen, die Klageschrift für Karlsruhe zu verfassen. Der Vorsitzende der KlimaUnion attestierte der Ampelkoalition eine "katastrophal" falsche Strategie für den Klimaschutz und eine "Wir wissen alles besser"-Haltung. "Die Dämmung ist wichtiger als die Heizung", betonte der Unternehmer, der nach eigenen Angaben von 2007 bis 2010 Kleingesellschafter bei Facebook sowie Mitgründer von Xing und MyToys war.
Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander attestierte der Bundesregierung beim Heizungsgesetz eine "Trotzreaktion". "Ich glaube, damit kommen sie nicht durch", erwartete er. Für die Ampel stehe aber bei dem "Formelkompromiss" viel auf dem Spiel. Allein dafür seien x-Anläufe nötig gewesen. "Die fragen sich, ob sie noch einen hinkriegen", mutmaßte Alexander. Eine Niederlage bei diesem Teil der Wärmewende hätte massive Auswirkungen. "Wenn das nicht klappt, hat man dem Klimaschutz in D echt einen Schlag versetzt", warnte Alexander.
Zitat von Gast am 14. Juli 2023, 05:18 Uhr„Böses Blut“
„Dreisteste Lohnerhöhung“: Scholz und Co wollen Extra-Prämie – aus kuriosem Grund
Die Bundesregierung will Beamten mit einem neuen Gesetz eine Inflationsprämie ermöglichen. Doch auch die Minister profitieren – und sacken 3000 Euro ein. Es hagelt Kritik.
Berlin – Kurz vor der Sommerpause gibt es für die Minister im Bundestag noch einmal Grund zum Feiern. Sie haben sich selbst einen fetten Bonus ermöglicht. Satte 3000 Euro steuerfrei soll es zusätzlich aufs Konto geben. Aus der Opposition kommt Kritik. Was steckt dahinter?
Extra-Prämie für Scholz und Co: Beschluss aus kuriosem Grund
Zur Stunde verabschiedet die Ampel-Regierung das „Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung.“ Damit sollen die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst auch auf alle Beamte des Bundes übertragen werden, informiert die Bundesregierung. Dazu zählen unter anderem Bundespolizisten, Soldaten und Ministeriumsmitarbeiter. Konkret geht es um eine steuerfreie 3000-Euro-Inflationsprämie und 5,5 Prozent monatlich mehr Lohn ab 2024, schreibt Bild.
Nachdem aber die Gehälter der Minister und des Kanzlers an den Beamtengehältern hängen, überträgt sich der Beschluss auch auf die obersten Regierungsmitglieder. Wie die Bild erfahren hat, wurde in Regierungskreisen diskutiert, auf die Prämie zu verzichten. Die Entscheidung lautete am Schluss jedoch: Behalten. Denn: Würden die Minister auf die Prämie verzichten, würden die höchsten Beamten unter ihnen, die Staatssekretäre, einmalig mehr verdienen als ihre Chefs.
Staatssekretäre verdienen laut Business Insider (Stand: Januar 2023) als Grundgehalt etwa 15.100 Euro, Minister etwa 17.000 Euro und der Kanzler 21.600 Euro.
Kritik an Extra-Prämie für Scholz und Co: „Dreisteste Lohnerhöhung“
Aus den Reihen der Opposition kommt Kritik am Sommer-Bonus der Regierung. „Die Ampel kommt fast täglich mit neuen Ideen um die Ecke, wie sie die Bürger noch weiter belasten kann“, so CDU-Gesundheits- und Familienexperte Erwin Rüddel gegenüber der Bild. „Und selbst genehmigen sich die Minister heute die dreisteste Lohnerhöhung des Jahres!“, schimpfte er.
„Es gibt böses Blut, wenn einerseits Kürzungen bei Familiengeld und Ehegattensplitting diskutiert werden und andererseits auch das Bundeskabinett 3000 Euro Inflationsausgleich bezieht“, schloss ich Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger an. Er empfahl Rückzahlungen.
Wie die Bild auf Nachfrage erfuhr, wollen folgende Mitglieder des Kabinetts ihren Bonus tatsächlich weitergeben:
Boris Pistorius, Wolfgang Schmidt und Karl Lauterbach von der SPD sowie die FDP-Minister Volker Wissing, Christian Lindner und Marco Buschmann antworteten nicht auf die Anfrage der Zeitung (Stand: 13. Juli). Steuerzahlerbund-Präsident Reiner Holznagel legte dem gesamten Kabinett nahe, „auf die Inflationsprämie verzichten.“ Die Minister sollten „mit gutem Beispiel voranzugehen und Sensibilität zeigen“, sagte er gegenüber der Zeitung. Auch Habecks Heizungsgesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossene Sache sein.
„Böses Blut“
„Dreisteste Lohnerhöhung“: Scholz und Co wollen Extra-Prämie – aus kuriosem Grund
Die Bundesregierung will Beamten mit einem neuen Gesetz eine Inflationsprämie ermöglichen. Doch auch die Minister profitieren – und sacken 3000 Euro ein. Es hagelt Kritik.
Berlin – Kurz vor der Sommerpause gibt es für die Minister im Bundestag noch einmal Grund zum Feiern. Sie haben sich selbst einen fetten Bonus ermöglicht. Satte 3000 Euro steuerfrei soll es zusätzlich aufs Konto geben. Aus der Opposition kommt Kritik. Was steckt dahinter?
Extra-Prämie für Scholz und Co: Beschluss aus kuriosem Grund
Zur Stunde verabschiedet die Ampel-Regierung das „Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung.“ Damit sollen die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst auch auf alle Beamte des Bundes übertragen werden, informiert die Bundesregierung. Dazu zählen unter anderem Bundespolizisten, Soldaten und Ministeriumsmitarbeiter. Konkret geht es um eine steuerfreie 3000-Euro-Inflationsprämie und 5,5 Prozent monatlich mehr Lohn ab 2024, schreibt Bild.
Nachdem aber die Gehälter der Minister und des Kanzlers an den Beamtengehältern hängen, überträgt sich der Beschluss auch auf die obersten Regierungsmitglieder. Wie die Bild erfahren hat, wurde in Regierungskreisen diskutiert, auf die Prämie zu verzichten. Die Entscheidung lautete am Schluss jedoch: Behalten. Denn: Würden die Minister auf die Prämie verzichten, würden die höchsten Beamten unter ihnen, die Staatssekretäre, einmalig mehr verdienen als ihre Chefs.
Staatssekretäre verdienen laut Business Insider (Stand: Januar 2023) als Grundgehalt etwa 15.100 Euro, Minister etwa 17.000 Euro und der Kanzler 21.600 Euro.
Kritik an Extra-Prämie für Scholz und Co: „Dreisteste Lohnerhöhung“
Aus den Reihen der Opposition kommt Kritik am Sommer-Bonus der Regierung. „Die Ampel kommt fast täglich mit neuen Ideen um die Ecke, wie sie die Bürger noch weiter belasten kann“, so CDU-Gesundheits- und Familienexperte Erwin Rüddel gegenüber der Bild. „Und selbst genehmigen sich die Minister heute die dreisteste Lohnerhöhung des Jahres!“, schimpfte er.
„Es gibt böses Blut, wenn einerseits Kürzungen bei Familiengeld und Ehegattensplitting diskutiert werden und andererseits auch das Bundeskabinett 3000 Euro Inflationsausgleich bezieht“, schloss ich Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger an. Er empfahl Rückzahlungen.
Wie die Bild auf Nachfrage erfuhr, wollen folgende Mitglieder des Kabinetts ihren Bonus tatsächlich weitergeben:
Boris Pistorius, Wolfgang Schmidt und Karl Lauterbach von der SPD sowie die FDP-Minister Volker Wissing, Christian Lindner und Marco Buschmann antworteten nicht auf die Anfrage der Zeitung (Stand: 13. Juli). Steuerzahlerbund-Präsident Reiner Holznagel legte dem gesamten Kabinett nahe, „auf die Inflationsprämie verzichten.“ Die Minister sollten „mit gutem Beispiel voranzugehen und Sensibilität zeigen“, sagte er gegenüber der Zeitung. Auch Habecks Heizungsgesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossene Sache sein.
Zitat von Gast am 14. Juli 2023, 05:42 Uhr«In Zukunft werden Unternehmen das Risiko selbst tragen müssen»: Deutschland präsentiert zum ersten Mal eine China-Strategie
Schon der Ort der Verkündung war ein Signal. Aussenministerin Annalena Baerbock stellte Deutschlands erste nationale Strategie im Umgang mit China nicht in ihrem Ministerium oder den Räumen der Bundespressekonferenz vor, sondern beim «Mercator Institute for China Studies» (Merics). Die Denkfabrik unterliegt seit über zwei Jahren Sanktionen von Chinas Kommunisten. Die Botschaft ist eindeutig: In Zukunft nimmt Berlin weniger Rücksicht auf das Befinden Pekings.
Vor allem in den Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte soll sich einiges ändern. «Wir können uns einfach kein zweites Mal, das leisten, was wir uns durch den russischen Angriffskrieg leisten mussten», sagte Baerbock am Donnerstag. «Nämlich über 200 Milliarden Euro gesamtgesellschaftlich dafür aufzuwenden, dass wir uns aus einer Abhängigkeit befreit haben.»
Die neue Strategie buchstabiert aus, was die «Ampel» schon länger kommuniziert: Die Interessen Deutschlands und jene deutscher Unternehmen sind nicht deckungsgleich. Der Staat wird in Zukunft weniger Risiken des China-Geschäfts übernehmen und bei einseitigen Importabhängigkeiten soll gegengesteuert werden.
Wie das alles konkret umgesetzt werden soll, bleibt offen. Und auch die viel beschworene Einigkeit der Regierung beim Thema China zeigt bereits erste Risse. Dennoch ist mit der Veröffentlichung der Strategie eins klar: Die deutsche Chinapolitik hat seit der Ära Merkel einen weiten Weg zurückgelegt.
Unternehmen müssen Risiken vermehrt selbst tragen
China produziere etwa 96 Prozent des weltweiten Galliums stellte Baerbock gleich zu Beginn ihrer Rede klar. Erst vor wenigen Tagen schränkte Peking den Export des seltenen Rohstoffes ein, der unter anderem zur Herstellung von Bildschirmen benötigt wird. Diese und ähnliche Abhängigkeiten nutze China für die Durchsetzung politischer Ziele, ist in der Strategie festgehalten.
Daher vertrat Baerbock wieder einmal das Credo des «de-risking», der Risikominimierung im wirtschaftlichen Umgang mit China. Einer Abkopplung («decoupling») vom chinesischen Markt erteilte sie, wie Kanzler Olaf Scholz, eine Absage.
Ein zentrales Instrument hierbei sind die staatlichen Investitionsgarantien. Diese sind Versicherungen, die der deutsche Staat Unternehmen ausspricht, die im Ausland operieren. Die Firmen zahlen dafür eine Gebühr, sind aber bei politischen Risiken wie Enteignungen oder einem militärischen Konflikt abgesichert.
«In guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen – das wird auf Dauer nicht funktionieren», sagte Baerbock. Nur um noch deutlicher nachzuschieben: «Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Masse vom chinesischen Markt abhängig machen, in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen.»
Konkret ist in der Strategie eine Deckelung der Investitionsgarantien festgeschrieben, so wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits im vergangenen November angekündigt hatte. Unternehmen müssen geopolitische Risiken stärker internalisieren, staatliche Investitionsgarantien sollen die Summe von drei Milliarden Euro pro Unternehmen pro Land nicht übersteigen.
Kann China auch in Zukunft Hafen-Anteile kaufen?
Auch chinesische Investitionen in Deutschland nimmt die Strategie in den Blick. Im vergangenen Jahr war im Kabinett ein Streit um eine Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens entbrannt. Am Schluss setzte sich der Kanzler durch, die Chinesen konnten mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 24,99 Prozent einsteigen.
«Dem Schutz Kritischer Infrastrukturen, zu denen insbesondere die Telekommunikations-, Daten-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur zählen, kommt eine wichtige Bedeutung zu», heisst es in der Strategie. Was das allerdings konkret bedeutet, bleibt offen. In dem Strategiedokument verweist die Regierung auf ein noch zu verabschiedendes Gesetz, das definieren soll, «welche Sektoren sowie welche Unternehmen und Einrichtungen zu den Kritischen Infrastrukturen gehören.»
SPD und Grüne verfolgen unterschiedliche Chinapolitik
Wie bei der Cosco-Beteiligung offensichtlich wurde, haben Grüne und SPD bei der China-Politik grundsätzlich andere Prioritäten. Während Baerbocks Partei Menschenrechte und Sicherheit wichtig sind, fürchten Sozialdemokraten die wirtschaftlichen Einbussen bei einem konfrontativen China-Kurs.
Ein im November geleakter Entwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt schlug noch einen sehr viel schärferen Ton als das am Donnerstag veröffentlichte Dokument an.
Nun ist in der Strategie festgehalten, dass sich die Regierung der «möglichen wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen» neuer Regulierungen von ausländischen Direktinvestitionen bewusst sei. Auch auf die anschliessende Passage wird vor allem das Kanzleramt besonders Wert gelegt haben: «Ausserhalb des Investitionsprüfverfahrens nutzen wir alle bestehenden, wirtschaftlich sinnvollen und nachhaltigen Möglichkeiten vollumfänglich, um Standorte und Arbeitsplätze zu sichern.»
Der SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid stellte in der anschliessenden Podiumsdiskussion klar, welche Punkte der Kanzlerpartei in der China-Strategie besonders wichtig sind: Die industriepolitische Stärkung des Standort Deutschlands sowie ein «abgestuftes de-risking», also keine allzu strenge Kontrolle von Wirtschaft und Investitionen aus China.
Bei Taiwan widerspricht Deutschland Macron
Deutschlands Partner in Asien wie Südkorea oder Japan wird vor allem die unmissverständliche Reaktion Berlins auf die zunehmenden Aggressionen Pekings im Südchinesischen Meer sowie in der Strasse von Taiwan beruhigen. Zum Thema Taiwan hält die Strategie fest: «Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.»
Damit setzt sich Deutschland klar von der aussenpolitischen Position Frankreichs ab. Im April hatte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Rückflug aus China gesagt, dass Europa bei dem Thema Taiwan riskiere, in Krisen hineingezogen werden, «die nicht unsere sind».
Auf die Umsetzung kommt es an
In der ersten deutschen China-Strategie steht wenig, was man nicht so schon von «Ampel»-Ministern in den letzten Monaten gehört hätte. Dennoch ist die Strategie in Teilen konkreter als die enttäuschende Nationale Sicherheitsstrategie und dazu ein Zeugnis des veränderten Blicks der grössten Volkswirtschaft Europas auf China. Das Dokument benennt klar «unfaire Praktiken» Pekings, die eine «Gefahr» für Deutschland sind. Worte, die der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel niemals über die Lippen gekommen wären.
Es kommt allerdings auf die Umsetzung der Strategie an. Denn wenn als ein Zaubermittel für mehr Diversifizierung neue Freihandelsabkommen wie jenes mit den Mercosur-Staaten genannt werden, muss man sich fragen, wie realistisch das ist. Das Abkommen mit dem lateinamerikanischen Wirtschaftsbund wird bereits seit 1999 verhandelt, ohne dass es bisher ratifiziert wurde.
Oder wenn in der Strategie versprochen wird, die freiheitliche demokratische Grundordnung gegen chinesische Einflussnahme zu schützen, fragt man sich, warum Deutschland bei der Pressekonferenz anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Chinas Wunsch respektierte, keine Fragen von Journalisten zuzulassen.
Auch die Wissenschaft moniert die fehlenden Handlungsperspektiven, die sich aus dem Strategiedokument ergeben. Am Donnerstag sagte die Ökonomin Katrin Keim vom Kieler Institut für Weltwirtschaft: «Der häufige Einsatz der Standardformulierung ‹sich für Ziel X einzusetzen›» zeige «mangelndes perspektivisches Denken». Wie der deutsche Industriestandort in Zukunft konkret verteidigt werde, bleibe im Verborgenen.
Deutschland hat in seinem Verhältnis zu China am Donnerstag offiziell einen neuen Weg beschritten. Wie es das Ziel erreicht, bleibt unklar.
«In Zukunft werden Unternehmen das Risiko selbst tragen müssen»: Deutschland präsentiert zum ersten Mal eine China-Strategie
Schon der Ort der Verkündung war ein Signal. Aussenministerin Annalena Baerbock stellte Deutschlands erste nationale Strategie im Umgang mit China nicht in ihrem Ministerium oder den Räumen der Bundespressekonferenz vor, sondern beim «Mercator Institute for China Studies» (Merics). Die Denkfabrik unterliegt seit über zwei Jahren Sanktionen von Chinas Kommunisten. Die Botschaft ist eindeutig: In Zukunft nimmt Berlin weniger Rücksicht auf das Befinden Pekings.
Vor allem in den Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte soll sich einiges ändern. «Wir können uns einfach kein zweites Mal, das leisten, was wir uns durch den russischen Angriffskrieg leisten mussten», sagte Baerbock am Donnerstag. «Nämlich über 200 Milliarden Euro gesamtgesellschaftlich dafür aufzuwenden, dass wir uns aus einer Abhängigkeit befreit haben.»
Die neue Strategie buchstabiert aus, was die «Ampel» schon länger kommuniziert: Die Interessen Deutschlands und jene deutscher Unternehmen sind nicht deckungsgleich. Der Staat wird in Zukunft weniger Risiken des China-Geschäfts übernehmen und bei einseitigen Importabhängigkeiten soll gegengesteuert werden.
Wie das alles konkret umgesetzt werden soll, bleibt offen. Und auch die viel beschworene Einigkeit der Regierung beim Thema China zeigt bereits erste Risse. Dennoch ist mit der Veröffentlichung der Strategie eins klar: Die deutsche Chinapolitik hat seit der Ära Merkel einen weiten Weg zurückgelegt.
Unternehmen müssen Risiken vermehrt selbst tragen
China produziere etwa 96 Prozent des weltweiten Galliums stellte Baerbock gleich zu Beginn ihrer Rede klar. Erst vor wenigen Tagen schränkte Peking den Export des seltenen Rohstoffes ein, der unter anderem zur Herstellung von Bildschirmen benötigt wird. Diese und ähnliche Abhängigkeiten nutze China für die Durchsetzung politischer Ziele, ist in der Strategie festgehalten.
Daher vertrat Baerbock wieder einmal das Credo des «de-risking», der Risikominimierung im wirtschaftlichen Umgang mit China. Einer Abkopplung («decoupling») vom chinesischen Markt erteilte sie, wie Kanzler Olaf Scholz, eine Absage.
Ein zentrales Instrument hierbei sind die staatlichen Investitionsgarantien. Diese sind Versicherungen, die der deutsche Staat Unternehmen ausspricht, die im Ausland operieren. Die Firmen zahlen dafür eine Gebühr, sind aber bei politischen Risiken wie Enteignungen oder einem militärischen Konflikt abgesichert.
«In guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen – das wird auf Dauer nicht funktionieren», sagte Baerbock. Nur um noch deutlicher nachzuschieben: «Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Masse vom chinesischen Markt abhängig machen, in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen.»
Konkret ist in der Strategie eine Deckelung der Investitionsgarantien festgeschrieben, so wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits im vergangenen November angekündigt hatte. Unternehmen müssen geopolitische Risiken stärker internalisieren, staatliche Investitionsgarantien sollen die Summe von drei Milliarden Euro pro Unternehmen pro Land nicht übersteigen.
Kann China auch in Zukunft Hafen-Anteile kaufen?
Auch chinesische Investitionen in Deutschland nimmt die Strategie in den Blick. Im vergangenen Jahr war im Kabinett ein Streit um eine Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens entbrannt. Am Schluss setzte sich der Kanzler durch, die Chinesen konnten mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 24,99 Prozent einsteigen.
«Dem Schutz Kritischer Infrastrukturen, zu denen insbesondere die Telekommunikations-, Daten-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur zählen, kommt eine wichtige Bedeutung zu», heisst es in der Strategie. Was das allerdings konkret bedeutet, bleibt offen. In dem Strategiedokument verweist die Regierung auf ein noch zu verabschiedendes Gesetz, das definieren soll, «welche Sektoren sowie welche Unternehmen und Einrichtungen zu den Kritischen Infrastrukturen gehören.»
SPD und Grüne verfolgen unterschiedliche Chinapolitik
Wie bei der Cosco-Beteiligung offensichtlich wurde, haben Grüne und SPD bei der China-Politik grundsätzlich andere Prioritäten. Während Baerbocks Partei Menschenrechte und Sicherheit wichtig sind, fürchten Sozialdemokraten die wirtschaftlichen Einbussen bei einem konfrontativen China-Kurs.
Ein im November geleakter Entwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt schlug noch einen sehr viel schärferen Ton als das am Donnerstag veröffentlichte Dokument an.
Nun ist in der Strategie festgehalten, dass sich die Regierung der «möglichen wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen» neuer Regulierungen von ausländischen Direktinvestitionen bewusst sei. Auch auf die anschliessende Passage wird vor allem das Kanzleramt besonders Wert gelegt haben: «Ausserhalb des Investitionsprüfverfahrens nutzen wir alle bestehenden, wirtschaftlich sinnvollen und nachhaltigen Möglichkeiten vollumfänglich, um Standorte und Arbeitsplätze zu sichern.»
Der SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid stellte in der anschliessenden Podiumsdiskussion klar, welche Punkte der Kanzlerpartei in der China-Strategie besonders wichtig sind: Die industriepolitische Stärkung des Standort Deutschlands sowie ein «abgestuftes de-risking», also keine allzu strenge Kontrolle von Wirtschaft und Investitionen aus China.
Bei Taiwan widerspricht Deutschland Macron
Deutschlands Partner in Asien wie Südkorea oder Japan wird vor allem die unmissverständliche Reaktion Berlins auf die zunehmenden Aggressionen Pekings im Südchinesischen Meer sowie in der Strasse von Taiwan beruhigen. Zum Thema Taiwan hält die Strategie fest: «Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.»
Damit setzt sich Deutschland klar von der aussenpolitischen Position Frankreichs ab. Im April hatte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Rückflug aus China gesagt, dass Europa bei dem Thema Taiwan riskiere, in Krisen hineingezogen werden, «die nicht unsere sind».
Auf die Umsetzung kommt es an
In der ersten deutschen China-Strategie steht wenig, was man nicht so schon von «Ampel»-Ministern in den letzten Monaten gehört hätte. Dennoch ist die Strategie in Teilen konkreter als die enttäuschende Nationale Sicherheitsstrategie und dazu ein Zeugnis des veränderten Blicks der grössten Volkswirtschaft Europas auf China. Das Dokument benennt klar «unfaire Praktiken» Pekings, die eine «Gefahr» für Deutschland sind. Worte, die der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel niemals über die Lippen gekommen wären.
Es kommt allerdings auf die Umsetzung der Strategie an. Denn wenn als ein Zaubermittel für mehr Diversifizierung neue Freihandelsabkommen wie jenes mit den Mercosur-Staaten genannt werden, muss man sich fragen, wie realistisch das ist. Das Abkommen mit dem lateinamerikanischen Wirtschaftsbund wird bereits seit 1999 verhandelt, ohne dass es bisher ratifiziert wurde.
Oder wenn in der Strategie versprochen wird, die freiheitliche demokratische Grundordnung gegen chinesische Einflussnahme zu schützen, fragt man sich, warum Deutschland bei der Pressekonferenz anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Chinas Wunsch respektierte, keine Fragen von Journalisten zuzulassen.
Auch die Wissenschaft moniert die fehlenden Handlungsperspektiven, die sich aus dem Strategiedokument ergeben. Am Donnerstag sagte die Ökonomin Katrin Keim vom Kieler Institut für Weltwirtschaft: «Der häufige Einsatz der Standardformulierung ‹sich für Ziel X einzusetzen›» zeige «mangelndes perspektivisches Denken». Wie der deutsche Industriestandort in Zukunft konkret verteidigt werde, bleibe im Verborgenen.
Deutschland hat in seinem Verhältnis zu China am Donnerstag offiziell einen neuen Weg beschritten. Wie es das Ziel erreicht, bleibt unklar.
Zitat von Gast am 14. Juli 2023, 05:44 Uhr«In Zukunft werden Unternehmen das Risiko selbst tragen müssen»: Deutschland präsentiert zum ersten Mal eine China-Strategie
Schon der Ort der Verkündung war ein Signal. Aussenministerin Annalena Baerbock stellte Deutschlands erste nationale Strategie im Umgang mit China nicht in ihrem Ministerium oder den Räumen der Bundespressekonferenz vor, sondern beim «Mercator Institute for China Studies» (Merics). Die Denkfabrik unterliegt seit über zwei Jahren Sanktionen von Chinas Kommunisten. Die Botschaft ist eindeutig: In Zukunft nimmt Berlin weniger Rücksicht auf das Befinden Pekings.
Vor allem in den Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte soll sich einiges ändern. «Wir können uns einfach kein zweites Mal, das leisten, was wir uns durch den russischen Angriffskrieg leisten mussten», sagte Baerbock am Donnerstag. «Nämlich über 200 Milliarden Euro gesamtgesellschaftlich dafür aufzuwenden, dass wir uns aus einer Abhängigkeit befreit haben.»
Die neue Strategie buchstabiert aus, was die «Ampel» schon länger kommuniziert: Die Interessen Deutschlands und jene deutscher Unternehmen sind nicht deckungsgleich. Der Staat wird in Zukunft weniger Risiken des China-Geschäfts übernehmen und bei einseitigen Importabhängigkeiten soll gegengesteuert werden.
Wie das alles konkret umgesetzt werden soll, bleibt offen. Und auch die viel beschworene Einigkeit der Regierung beim Thema China zeigt bereits erste Risse. Dennoch ist mit der Veröffentlichung der Strategie eins klar: Die deutsche Chinapolitik hat seit der Ära Merkel einen weiten Weg zurückgelegt.
Unternehmen müssen Risiken vermehrt selbst tragen
China produziere etwa 96 Prozent des weltweiten Galliums stellte Baerbock gleich zu Beginn ihrer Rede klar. Erst vor wenigen Tagen schränkte Peking den Export des seltenen Rohstoffes ein, der unter anderem zur Herstellung von Bildschirmen benötigt wird. Diese und ähnliche Abhängigkeiten nutze China für die Durchsetzung politischer Ziele, ist in der Strategie festgehalten.
Daher vertrat Baerbock wieder einmal das Credo des «de-risking», der Risikominimierung im wirtschaftlichen Umgang mit China. Einer Abkopplung («decoupling») vom chinesischen Markt erteilte sie, wie Kanzler Olaf Scholz, eine Absage.
Ein zentrales Instrument hierbei sind die staatlichen Investitionsgarantien. Diese sind Versicherungen, die der deutsche Staat Unternehmen ausspricht, die im Ausland operieren. Die Firmen zahlen dafür eine Gebühr, sind aber bei politischen Risiken wie Enteignungen oder einem militärischen Konflikt abgesichert.
«In guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen – das wird auf Dauer nicht funktionieren», sagte Baerbock. Nur um noch deutlicher nachzuschieben: «Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Masse vom chinesischen Markt abhängig machen, in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen.»
Konkret ist in der Strategie eine Deckelung der Investitionsgarantien festgeschrieben, so wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits im vergangenen November angekündigt hatte. Unternehmen müssen geopolitische Risiken stärker internalisieren, staatliche Investitionsgarantien sollen die Summe von drei Milliarden Euro pro Unternehmen pro Land nicht übersteigen.
Kann China auch in Zukunft Hafen-Anteile kaufen?
Auch chinesische Investitionen in Deutschland nimmt die Strategie in den Blick. Im vergangenen Jahr war im Kabinett ein Streit um eine Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens entbrannt. Am Schluss setzte sich der Kanzler durch, die Chinesen konnten mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 24,99 Prozent einsteigen.
«Dem Schutz Kritischer Infrastrukturen, zu denen insbesondere die Telekommunikations-, Daten-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur zählen, kommt eine wichtige Bedeutung zu», heisst es in der Strategie. Was das allerdings konkret bedeutet, bleibt offen. In dem Strategiedokument verweist die Regierung auf ein noch zu verabschiedendes Gesetz, das definieren soll, «welche Sektoren sowie welche Unternehmen und Einrichtungen zu den Kritischen Infrastrukturen gehören.»
SPD und Grüne verfolgen unterschiedliche Chinapolitik
Wie bei der Cosco-Beteiligung offensichtlich wurde, haben Grüne und SPD bei der China-Politik grundsätzlich andere Prioritäten. Während Baerbocks Partei Menschenrechte und Sicherheit wichtig sind, fürchten Sozialdemokraten die wirtschaftlichen Einbussen bei einem konfrontativen China-Kurs.
Ein im November geleakter Entwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt schlug noch einen sehr viel schärferen Ton als das am Donnerstag veröffentlichte Dokument an.
Nun ist in der Strategie festgehalten, dass sich die Regierung der «möglichen wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen» neuer Regulierungen von ausländischen Direktinvestitionen bewusst sei. Auch auf die anschliessende Passage wird vor allem das Kanzleramt besonders Wert gelegt haben: «Ausserhalb des Investitionsprüfverfahrens nutzen wir alle bestehenden, wirtschaftlich sinnvollen und nachhaltigen Möglichkeiten vollumfänglich, um Standorte und Arbeitsplätze zu sichern.»
Der SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid stellte in der anschliessenden Podiumsdiskussion klar, welche Punkte der Kanzlerpartei in der China-Strategie besonders wichtig sind: Die industriepolitische Stärkung des Standort Deutschlands sowie ein «abgestuftes de-risking», also keine allzu strenge Kontrolle von Wirtschaft und Investitionen aus China.
Bei Taiwan widerspricht Deutschland Macron
Deutschlands Partner in Asien wie Südkorea oder Japan wird vor allem die unmissverständliche Reaktion Berlins auf die zunehmenden Aggressionen Pekings im Südchinesischen Meer sowie in der Strasse von Taiwan beruhigen. Zum Thema Taiwan hält die Strategie fest: «Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.»
Damit setzt sich Deutschland klar von der aussenpolitischen Position Frankreichs ab. Im April hatte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Rückflug aus China gesagt, dass Europa bei dem Thema Taiwan riskiere, in Krisen hineingezogen werden, «die nicht unsere sind».
Auf die Umsetzung kommt es an
In der ersten deutschen China-Strategie steht wenig, was man nicht so schon von «Ampel»-Ministern in den letzten Monaten gehört hätte. Dennoch ist die Strategie in Teilen konkreter als die enttäuschende Nationale Sicherheitsstrategie und dazu ein Zeugnis des veränderten Blicks der grössten Volkswirtschaft Europas auf China. Das Dokument benennt klar «unfaire Praktiken» Pekings, die eine «Gefahr» für Deutschland sind. Worte, die der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel niemals über die Lippen gekommen wären.
Es kommt allerdings auf die Umsetzung der Strategie an. Denn wenn als ein Zaubermittel für mehr Diversifizierung neue Freihandelsabkommen wie jenes mit den Mercosur-Staaten genannt werden, muss man sich fragen, wie realistisch das ist. Das Abkommen mit dem lateinamerikanischen Wirtschaftsbund wird bereits seit 1999 verhandelt, ohne dass es bisher ratifiziert wurde.
Oder wenn in der Strategie versprochen wird, die freiheitliche demokratische Grundordnung gegen chinesische Einflussnahme zu schützen, fragt man sich, warum Deutschland bei der Pressekonferenz anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Chinas Wunsch respektierte, keine Fragen von Journalisten zuzulassen.
Auch die Wissenschaft moniert die fehlenden Handlungsperspektiven, die sich aus dem Strategiedokument ergeben. Am Donnerstag sagte die Ökonomin Katrin Keim vom Kieler Institut für Weltwirtschaft: «Der häufige Einsatz der Standardformulierung ‹sich für Ziel X einzusetzen›» zeige «mangelndes perspektivisches Denken». Wie der deutsche Industriestandort in Zukunft konkret verteidigt werde, bleibe im Verborgenen.
Deutschland hat in seinem Verhältnis zu China am Donnerstag offiziell einen neuen Weg beschritten. Wie es das Ziel erreicht, bleibt unklar.
«In Zukunft werden Unternehmen das Risiko selbst tragen müssen»: Deutschland präsentiert zum ersten Mal eine China-Strategie
Schon der Ort der Verkündung war ein Signal. Aussenministerin Annalena Baerbock stellte Deutschlands erste nationale Strategie im Umgang mit China nicht in ihrem Ministerium oder den Räumen der Bundespressekonferenz vor, sondern beim «Mercator Institute for China Studies» (Merics). Die Denkfabrik unterliegt seit über zwei Jahren Sanktionen von Chinas Kommunisten. Die Botschaft ist eindeutig: In Zukunft nimmt Berlin weniger Rücksicht auf das Befinden Pekings.
Vor allem in den Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte soll sich einiges ändern. «Wir können uns einfach kein zweites Mal, das leisten, was wir uns durch den russischen Angriffskrieg leisten mussten», sagte Baerbock am Donnerstag. «Nämlich über 200 Milliarden Euro gesamtgesellschaftlich dafür aufzuwenden, dass wir uns aus einer Abhängigkeit befreit haben.»
Die neue Strategie buchstabiert aus, was die «Ampel» schon länger kommuniziert: Die Interessen Deutschlands und jene deutscher Unternehmen sind nicht deckungsgleich. Der Staat wird in Zukunft weniger Risiken des China-Geschäfts übernehmen und bei einseitigen Importabhängigkeiten soll gegengesteuert werden.
Wie das alles konkret umgesetzt werden soll, bleibt offen. Und auch die viel beschworene Einigkeit der Regierung beim Thema China zeigt bereits erste Risse. Dennoch ist mit der Veröffentlichung der Strategie eins klar: Die deutsche Chinapolitik hat seit der Ära Merkel einen weiten Weg zurückgelegt.
Unternehmen müssen Risiken vermehrt selbst tragen
China produziere etwa 96 Prozent des weltweiten Galliums stellte Baerbock gleich zu Beginn ihrer Rede klar. Erst vor wenigen Tagen schränkte Peking den Export des seltenen Rohstoffes ein, der unter anderem zur Herstellung von Bildschirmen benötigt wird. Diese und ähnliche Abhängigkeiten nutze China für die Durchsetzung politischer Ziele, ist in der Strategie festgehalten.
Daher vertrat Baerbock wieder einmal das Credo des «de-risking», der Risikominimierung im wirtschaftlichen Umgang mit China. Einer Abkopplung («decoupling») vom chinesischen Markt erteilte sie, wie Kanzler Olaf Scholz, eine Absage.
Ein zentrales Instrument hierbei sind die staatlichen Investitionsgarantien. Diese sind Versicherungen, die der deutsche Staat Unternehmen ausspricht, die im Ausland operieren. Die Firmen zahlen dafür eine Gebühr, sind aber bei politischen Risiken wie Enteignungen oder einem militärischen Konflikt abgesichert.
«In guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen – das wird auf Dauer nicht funktionieren», sagte Baerbock. Nur um noch deutlicher nachzuschieben: «Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Masse vom chinesischen Markt abhängig machen, in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen.»
Konkret ist in der Strategie eine Deckelung der Investitionsgarantien festgeschrieben, so wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits im vergangenen November angekündigt hatte. Unternehmen müssen geopolitische Risiken stärker internalisieren, staatliche Investitionsgarantien sollen die Summe von drei Milliarden Euro pro Unternehmen pro Land nicht übersteigen.
Kann China auch in Zukunft Hafen-Anteile kaufen?
Auch chinesische Investitionen in Deutschland nimmt die Strategie in den Blick. Im vergangenen Jahr war im Kabinett ein Streit um eine Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens entbrannt. Am Schluss setzte sich der Kanzler durch, die Chinesen konnten mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 24,99 Prozent einsteigen.
«Dem Schutz Kritischer Infrastrukturen, zu denen insbesondere die Telekommunikations-, Daten-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur zählen, kommt eine wichtige Bedeutung zu», heisst es in der Strategie. Was das allerdings konkret bedeutet, bleibt offen. In dem Strategiedokument verweist die Regierung auf ein noch zu verabschiedendes Gesetz, das definieren soll, «welche Sektoren sowie welche Unternehmen und Einrichtungen zu den Kritischen Infrastrukturen gehören.»
SPD und Grüne verfolgen unterschiedliche Chinapolitik
Wie bei der Cosco-Beteiligung offensichtlich wurde, haben Grüne und SPD bei der China-Politik grundsätzlich andere Prioritäten. Während Baerbocks Partei Menschenrechte und Sicherheit wichtig sind, fürchten Sozialdemokraten die wirtschaftlichen Einbussen bei einem konfrontativen China-Kurs.
Ein im November geleakter Entwurf der China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt schlug noch einen sehr viel schärferen Ton als das am Donnerstag veröffentlichte Dokument an.
Nun ist in der Strategie festgehalten, dass sich die Regierung der «möglichen wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen» neuer Regulierungen von ausländischen Direktinvestitionen bewusst sei. Auch auf die anschliessende Passage wird vor allem das Kanzleramt besonders Wert gelegt haben: «Ausserhalb des Investitionsprüfverfahrens nutzen wir alle bestehenden, wirtschaftlich sinnvollen und nachhaltigen Möglichkeiten vollumfänglich, um Standorte und Arbeitsplätze zu sichern.»
Der SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid stellte in der anschliessenden Podiumsdiskussion klar, welche Punkte der Kanzlerpartei in der China-Strategie besonders wichtig sind: Die industriepolitische Stärkung des Standort Deutschlands sowie ein «abgestuftes de-risking», also keine allzu strenge Kontrolle von Wirtschaft und Investitionen aus China.
Bei Taiwan widerspricht Deutschland Macron
Deutschlands Partner in Asien wie Südkorea oder Japan wird vor allem die unmissverständliche Reaktion Berlins auf die zunehmenden Aggressionen Pekings im Südchinesischen Meer sowie in der Strasse von Taiwan beruhigen. Zum Thema Taiwan hält die Strategie fest: «Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.»
Damit setzt sich Deutschland klar von der aussenpolitischen Position Frankreichs ab. Im April hatte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Rückflug aus China gesagt, dass Europa bei dem Thema Taiwan riskiere, in Krisen hineingezogen werden, «die nicht unsere sind».
Auf die Umsetzung kommt es an
In der ersten deutschen China-Strategie steht wenig, was man nicht so schon von «Ampel»-Ministern in den letzten Monaten gehört hätte. Dennoch ist die Strategie in Teilen konkreter als die enttäuschende Nationale Sicherheitsstrategie und dazu ein Zeugnis des veränderten Blicks der grössten Volkswirtschaft Europas auf China. Das Dokument benennt klar «unfaire Praktiken» Pekings, die eine «Gefahr» für Deutschland sind. Worte, die der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel niemals über die Lippen gekommen wären.
Es kommt allerdings auf die Umsetzung der Strategie an. Denn wenn als ein Zaubermittel für mehr Diversifizierung neue Freihandelsabkommen wie jenes mit den Mercosur-Staaten genannt werden, muss man sich fragen, wie realistisch das ist. Das Abkommen mit dem lateinamerikanischen Wirtschaftsbund wird bereits seit 1999 verhandelt, ohne dass es bisher ratifiziert wurde.
Oder wenn in der Strategie versprochen wird, die freiheitliche demokratische Grundordnung gegen chinesische Einflussnahme zu schützen, fragt man sich, warum Deutschland bei der Pressekonferenz anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Chinas Wunsch respektierte, keine Fragen von Journalisten zuzulassen.
Auch die Wissenschaft moniert die fehlenden Handlungsperspektiven, die sich aus dem Strategiedokument ergeben. Am Donnerstag sagte die Ökonomin Katrin Keim vom Kieler Institut für Weltwirtschaft: «Der häufige Einsatz der Standardformulierung ‹sich für Ziel X einzusetzen›» zeige «mangelndes perspektivisches Denken». Wie der deutsche Industriestandort in Zukunft konkret verteidigt werde, bleibe im Verborgenen.
Deutschland hat in seinem Verhältnis zu China am Donnerstag offiziell einen neuen Weg beschritten. Wie es das Ziel erreicht, bleibt unklar.
Zitat von Gast am 17. Juli 2023, 09:45 UhrOlaf Scholz und die China-Strategie: Die Welt schüttelt den Kopf über den Bundeskanzler
Die China-Strategie zeigt das ganze Dilemma, in das sich Deutschland gebracht hat: Einerseits versucht die Bundesregierung, China gegenüber weiter freundlich zu sein, um den größten Handelspartner nicht zu verprellen. Zum anderen werden einige Menschrechtsthemen angeschnitten.
Chinas Reaktion, nachzulesen in den chinesischen Staatsmedien, zeigt, dass Peking sich nicht für dumm verkaufen lassen will. Einhellig stellen chinesische Analysten und Experten fest, dass die vermeintlich feinsinnige Unterscheidung zwischen „de-risking“ und „de-coupling“ eine Wortklauberei ist. Das offizielle Peking reagierte auf das Papier mit einem diplomatischen Stoßseufzer: Man hoffe, dass Berlin seine Beziehungen zu China auf der Grundlage einer rationalen Politik gestalten werde.
Für die Transatlantiker ergriff Norbert Röttgen das Wort und warf dem Bundeskanzler Olaf Scholz „mangelnden Realismus“ im Hinblick auf das wahre Gesicht Chinas vor. Trotz der ausdrücklichen Nennung von konkreten Menschenrechtsverstößen wie etwa gegen die Uiguren in dem Papier zog Röttgen in der FAZ ein vernichtendes Fazit: „Die Bundesregierung knickt vor China ein.“ Konkret dürfte das Papier daher vor allem eines sein: eine Bestätigung des bisherigen Kurses des Lavierens der Bundesrepublik zwischen den Großmächten. Ist das der richtige Weg?
Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Auch nach den jüngsten Besuchen der amerikanischen Minister Antony Blinken und Janet Yellen in Peking ist nicht zu erkennen, wie sich die Beziehung künftig gestalten wird. Doch China und die USA werden immer Wege finden, um ihre jeweiligen wirtschaftlichen Interessen abzugleichen. Vor allem werden beide Großmächte keine Gelegenheit auslassen, um sich auf Kosten Dritter Vorteile zu verschaffen. Sie vertreten ihre Interessen – notfalls mit militärischer Gewalt, jedenfalls aber ohne Skrupel.
Das zeigt sich deutlich am für Deutschland wichtigsten Wirtschaftssektor, der Automobilindustrie. Um den riesigen chinesischen Markt für Elektroautos ist ein globaler Wettbewerb entbrannt. Die deutschen Autohersteller haben schlechte Karten – nicht zuletzt, weil sie in den vergangenen Jahren durch die Betrügereien bei den Abgastests die Fokussierung verloren haben. Während sich VW und andere mit Gerichten und Strafzahlungen herumschlagen mussten, entwickelte Tesla seine Technologie unter dem Radar weiter und baute schließlich direkt vor der Nase der deutschen Hersteller eine „Gigafactory“ in Grünheide. In den vergangenen Jahren ging bei allen ausländischen Herstellern der Verkauf in China zurück – außer bei Tesla. China setzt auf seine eigenen Produzenten: Unter den zehn erfolgreichsten Verkäufern von Elektroautos in China fanden sich in den ersten fünf Monaten laut den Zahlen des chinesischen Automobilverbandes acht chinesische Unternehmen. Tesla konnte mithalten und erreichte den zweiten Platz. VW ist der einzige deutsche Konzern, der es in die Top Ten schaffte – die Wolfsburger landeten jedoch abgeschlagen auf Platz acht. Und die Chinesen wollen weitermarschieren: Man strebe an, innerhalb der nächsten zehn Jahre zu den ersten drei in Europa zu gehören, wenn möglich sogar Marktführer zu werden, sagte Michael Shu, der Europachef des führenden chinesischen Herstellers BYD, in der Financial Times. Um diesen Vormarsch abzusichern, scheut die Regierung in Peking auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück: Vor allem die Exportbeschränkungen für die Rohstoffe Gallium und Germanium verschaffen den chinesischen Autoherstellern einen klaren Startvorteil.
Doch auch die Amerikaner sind nicht zimperlich: Mit dem sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) hat Washington vor allem den Europäern eine Bombe vor die Tür gelegt. Der IRA ist nämlich nichts anderes als ein knallhartes Protektionismus-Programm, das Industrien und Unternehmen aus aller Welt mit Milliardensubventionen in die USA lockt. Eine EU-Antwort gab es bisher nicht, die regionalen Reaktionen wirkten hilflos: So versprachen Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck dem amerikanischen Hersteller Intel knapp zehn Milliarden Euro Förderung für ein geplantes Werk in Magdeburg, das etwa 3000 Arbeitsplätze schaffen soll – weil Deutschland die Abhängigkeit seiner Autoindustrie von China bei Halbleitern reduzieren will.
Die Lage für Deutschland ist verfahren: Die Bundesregierung erkennt nicht, was deutsche Interessen sind, und kann diese folglich auch nirgends durchsetzen. Es fehlt ihr der realistische Blick auf sich selbst. Und so läuft dieses Land Gefahr, zwischen den Blöcken aufgerieben zu werden. Das Lavieren von heute ist der Totentanz von morgen.
Olaf Scholz und die China-Strategie: Die Welt schüttelt den Kopf über den Bundeskanzler
Die China-Strategie zeigt das ganze Dilemma, in das sich Deutschland gebracht hat: Einerseits versucht die Bundesregierung, China gegenüber weiter freundlich zu sein, um den größten Handelspartner nicht zu verprellen. Zum anderen werden einige Menschrechtsthemen angeschnitten.
Chinas Reaktion, nachzulesen in den chinesischen Staatsmedien, zeigt, dass Peking sich nicht für dumm verkaufen lassen will. Einhellig stellen chinesische Analysten und Experten fest, dass die vermeintlich feinsinnige Unterscheidung zwischen „de-risking“ und „de-coupling“ eine Wortklauberei ist. Das offizielle Peking reagierte auf das Papier mit einem diplomatischen Stoßseufzer: Man hoffe, dass Berlin seine Beziehungen zu China auf der Grundlage einer rationalen Politik gestalten werde.
Für die Transatlantiker ergriff Norbert Röttgen das Wort und warf dem Bundeskanzler Olaf Scholz „mangelnden Realismus“ im Hinblick auf das wahre Gesicht Chinas vor. Trotz der ausdrücklichen Nennung von konkreten Menschenrechtsverstößen wie etwa gegen die Uiguren in dem Papier zog Röttgen in der FAZ ein vernichtendes Fazit: „Die Bundesregierung knickt vor China ein.“ Konkret dürfte das Papier daher vor allem eines sein: eine Bestätigung des bisherigen Kurses des Lavierens der Bundesrepublik zwischen den Großmächten. Ist das der richtige Weg?
Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Auch nach den jüngsten Besuchen der amerikanischen Minister Antony Blinken und Janet Yellen in Peking ist nicht zu erkennen, wie sich die Beziehung künftig gestalten wird. Doch China und die USA werden immer Wege finden, um ihre jeweiligen wirtschaftlichen Interessen abzugleichen. Vor allem werden beide Großmächte keine Gelegenheit auslassen, um sich auf Kosten Dritter Vorteile zu verschaffen. Sie vertreten ihre Interessen – notfalls mit militärischer Gewalt, jedenfalls aber ohne Skrupel.
Das zeigt sich deutlich am für Deutschland wichtigsten Wirtschaftssektor, der Automobilindustrie. Um den riesigen chinesischen Markt für Elektroautos ist ein globaler Wettbewerb entbrannt. Die deutschen Autohersteller haben schlechte Karten – nicht zuletzt, weil sie in den vergangenen Jahren durch die Betrügereien bei den Abgastests die Fokussierung verloren haben. Während sich VW und andere mit Gerichten und Strafzahlungen herumschlagen mussten, entwickelte Tesla seine Technologie unter dem Radar weiter und baute schließlich direkt vor der Nase der deutschen Hersteller eine „Gigafactory“ in Grünheide. In den vergangenen Jahren ging bei allen ausländischen Herstellern der Verkauf in China zurück – außer bei Tesla. China setzt auf seine eigenen Produzenten: Unter den zehn erfolgreichsten Verkäufern von Elektroautos in China fanden sich in den ersten fünf Monaten laut den Zahlen des chinesischen Automobilverbandes acht chinesische Unternehmen. Tesla konnte mithalten und erreichte den zweiten Platz. VW ist der einzige deutsche Konzern, der es in die Top Ten schaffte – die Wolfsburger landeten jedoch abgeschlagen auf Platz acht. Und die Chinesen wollen weitermarschieren: Man strebe an, innerhalb der nächsten zehn Jahre zu den ersten drei in Europa zu gehören, wenn möglich sogar Marktführer zu werden, sagte Michael Shu, der Europachef des führenden chinesischen Herstellers BYD, in der Financial Times. Um diesen Vormarsch abzusichern, scheut die Regierung in Peking auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück: Vor allem die Exportbeschränkungen für die Rohstoffe Gallium und Germanium verschaffen den chinesischen Autoherstellern einen klaren Startvorteil.
Doch auch die Amerikaner sind nicht zimperlich: Mit dem sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) hat Washington vor allem den Europäern eine Bombe vor die Tür gelegt. Der IRA ist nämlich nichts anderes als ein knallhartes Protektionismus-Programm, das Industrien und Unternehmen aus aller Welt mit Milliardensubventionen in die USA lockt. Eine EU-Antwort gab es bisher nicht, die regionalen Reaktionen wirkten hilflos: So versprachen Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck dem amerikanischen Hersteller Intel knapp zehn Milliarden Euro Förderung für ein geplantes Werk in Magdeburg, das etwa 3000 Arbeitsplätze schaffen soll – weil Deutschland die Abhängigkeit seiner Autoindustrie von China bei Halbleitern reduzieren will.
Die Lage für Deutschland ist verfahren: Die Bundesregierung erkennt nicht, was deutsche Interessen sind, und kann diese folglich auch nirgends durchsetzen. Es fehlt ihr der realistische Blick auf sich selbst. Und so läuft dieses Land Gefahr, zwischen den Blöcken aufgerieben zu werden. Das Lavieren von heute ist der Totentanz von morgen.
Zitat von Gast am 19. Juli 2023, 08:39 UhrNur ein Prozent des Geldes ist bei der Truppe angekommen
100 Milliarden Euro Sondervermögen
Nur ein Prozent des Geldes ist bei der Truppe angekommen
100 Milliarden Euro hat die Bundesregierung zur Modernisierung der Bundeswehr bereitgestellt. Bei der Truppe kommt das Geld bislang aber nicht an.
Die Bundeswehr hat auch rund anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit veralteter Technik und Personalproblemen zu kämpfen. Das von der Bundesregierung bereitgestellte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sollte eigentlich genutzt werden, um das Arsenal der Bundeswehr zu modernisieren und bestehende Probleme auszumerzen.
Viel Lob gab es damals aus der Truppe und Teilen der Bevölkerung für die Ampelregierung. Knapp anderthalb Jahre später ist vom Optimismus hinsichtlich einer schnellen Modernisierung der Bundeswehr allerdings wenig übriggeblieben. Denn von den versprochenen 100 Milliarden Euro ist bislang knapp ein Prozent des Geldes in die Truppe investiert worden, nur knapp ein Drittel ist bislang für weitere Investitionen verplant, berichtet die "Tagesschau".
Nur ein Drittel des Sondervermögens ist verplant
Auf eine Anfrage der ARD teilte das Bundesverteidigungsministerium Mitte Juni mit, bisher seien lediglich 1,2 Milliarden Euro von den zur Verfügung stehenden 100 Milliarden Euro abgeflossen. Grund für die Verzögerung sei, dass das Geld erst dann abfließen könne, sobald bestelltes Militärgerät tatsächlich geliefert wird. Bei Großprojekten wie modernen Kampf- und Schützenpanzern dauere das eben seine Zeit, heißt es aus dem Ministerium.
Zwei Drittel des Sondervermögens sollen bis Ende des Jahres verplant sein, wenn es nach der Bundesregierung geht. Das könne in Form von Verträgen und anderen festen Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie passieren. Bisher ist allerdings nur ein Drittel der im Sondervermögen enthaltenen Kreditoptionen vertraglich gebunden. Weitere 33 Milliarden bis zum Jahresende in weniger als sechs Monaten zu verplanen, stellt eine Mammutaufgabe für die Bundesregierung dar.
CDU kritisiert die Ampel
Kritik am langsamen Abfluss des Sondervermögens kommt von der CDU. Der christdemokratische Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wirft der Bundeswehr im Gespräch mit der ARD mangelnden Willen zur Umsetzung vor: "Wo ein politischer Wille ist, kann man auch sehr schnell Abflüsse schaffen", sagte Kiesewetter.
Die Ampelkoalition weist die Vorwürfe des CDU-Mannes zurück. "Die Ampel legt ein hohes Tempo vor", meint der FDP-Abgeordnete Karsten Klein. Ein Beispiel dafür sei der Kauf des Flugabwehrsystems "Arrow 3", für den der Bundestag bereits die Mittel freigegeben hat. "Von einer solchen Geschwindigkeit hat die Union in ihrer Zeit in der Verantwortung im Vereidigungsministerium nur träumen können", sagte Klein der ARD.
Nur ein Prozent des Geldes ist bei der Truppe angekommen
100 Milliarden Euro Sondervermögen
Nur ein Prozent des Geldes ist bei der Truppe angekommen
100 Milliarden Euro hat die Bundesregierung zur Modernisierung der Bundeswehr bereitgestellt. Bei der Truppe kommt das Geld bislang aber nicht an.
Die Bundeswehr hat auch rund anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit veralteter Technik und Personalproblemen zu kämpfen. Das von der Bundesregierung bereitgestellte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sollte eigentlich genutzt werden, um das Arsenal der Bundeswehr zu modernisieren und bestehende Probleme auszumerzen.
Viel Lob gab es damals aus der Truppe und Teilen der Bevölkerung für die Ampelregierung. Knapp anderthalb Jahre später ist vom Optimismus hinsichtlich einer schnellen Modernisierung der Bundeswehr allerdings wenig übriggeblieben. Denn von den versprochenen 100 Milliarden Euro ist bislang knapp ein Prozent des Geldes in die Truppe investiert worden, nur knapp ein Drittel ist bislang für weitere Investitionen verplant, berichtet die "Tagesschau".
Nur ein Drittel des Sondervermögens ist verplant
Auf eine Anfrage der ARD teilte das Bundesverteidigungsministerium Mitte Juni mit, bisher seien lediglich 1,2 Milliarden Euro von den zur Verfügung stehenden 100 Milliarden Euro abgeflossen. Grund für die Verzögerung sei, dass das Geld erst dann abfließen könne, sobald bestelltes Militärgerät tatsächlich geliefert wird. Bei Großprojekten wie modernen Kampf- und Schützenpanzern dauere das eben seine Zeit, heißt es aus dem Ministerium.
Zwei Drittel des Sondervermögens sollen bis Ende des Jahres verplant sein, wenn es nach der Bundesregierung geht. Das könne in Form von Verträgen und anderen festen Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie passieren. Bisher ist allerdings nur ein Drittel der im Sondervermögen enthaltenen Kreditoptionen vertraglich gebunden. Weitere 33 Milliarden bis zum Jahresende in weniger als sechs Monaten zu verplanen, stellt eine Mammutaufgabe für die Bundesregierung dar.
CDU kritisiert die Ampel
Kritik am langsamen Abfluss des Sondervermögens kommt von der CDU. Der christdemokratische Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wirft der Bundeswehr im Gespräch mit der ARD mangelnden Willen zur Umsetzung vor: "Wo ein politischer Wille ist, kann man auch sehr schnell Abflüsse schaffen", sagte Kiesewetter.
Die Ampelkoalition weist die Vorwürfe des CDU-Mannes zurück. "Die Ampel legt ein hohes Tempo vor", meint der FDP-Abgeordnete Karsten Klein. Ein Beispiel dafür sei der Kauf des Flugabwehrsystems "Arrow 3", für den der Bundestag bereits die Mittel freigegeben hat. "Von einer solchen Geschwindigkeit hat die Union in ihrer Zeit in der Verantwortung im Vereidigungsministerium nur träumen können", sagte Klein der ARD.
Zitat von Gast am 20. Juli 2023, 05:50 UhrSERIE - Adieu, soziale Marktwirtschaft? Wie der deutsche Staat den Aufbau von Wohlstand verhindert
Berlin an einem kalten Abend im vergangenen Februar. Rainer Dulger sitzt in einem Restaurant im Ortsteil Charlottenburg und ist sichtlich angeschlagen: Die Nase läuft, er hustet. Doch es ist nicht das eigene Wohlbefinden, das ihn an diesem Abend umtreibt, «die Erkältung geht schon wieder vorbei», sagt er. Nein, Sorgen bereitet ihm ein anderer Patient: die Bundesrepublik Deutschland.
Der Cocktail aus Krieg, Inflation und teurer Energie sei eine heftige Mischung für das Land, gibt der Präsident der mächtigen Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an diesem Abend warnend zu bedenken. Europas grösste Volkswirtschaft drohe zum kranken Mann des Kontinents zu werden. Die Konsequenzen für die Bürger wären drastisch: Ihr Wohlstand ist in Gefahr.
Es brauche eine «klare Analyse und beherztes Handeln», damit das angeschlagene Land wieder auf die Beine komme, so appellierte Dulger daher an die Bundesregierung. Denn nicht zuletzt sie sieht er in der Pflicht: Während man ihr die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht vorwerfen könne, müsse sie sich aber der Kritik stellen, zu wenig zu unternehmen, um Bürger und Betriebe zu entlasten.
Es ist ein Vorwurf, den Wirtschaftsexperten schon lange äussern – und der jüngst von neuen Zahlen der Industrieländerorganisation OECD eindrücklich untermauert wurde. Ein Durchschnittsverdiener musste in Deutschland 2022 demnach mittlerweile beinahe jeden zweiten Euro seines Einkommens dafür aufwenden, seine Steuern zu zahlen und seine Beiträge für die Sozialversicherungen zu begleichen. Es ist ein fragwürdiger Rekord: Nur in Belgien werden Arbeitnehmer laut OECD noch stärker zur Kasse gebeten.
Wenig besser sieht die Situation für Familien aus: Im Schnitt kassierte der deutsche Staat bei einem Doppelverdiener-Paar mit Kindern im vergangenen Jahr 40,8 Prozent der Bezüge in Form von Steuern und Abgaben. Das ist weit entfernt von der durchschnittlichen Abgabenlast in anderen Industrieländern und noch weiter entfernt von Nachbarländern wie der Schweiz, wo der Staat seine Bürger mit Abgaben belastet, die im Schnitt nur halb so hoch liegen.
Vor allem die deutsche Mittelschicht trifft die hohe Kostenlast: Sie geriet in letzter Zeit unter Druck und schrumpft. Seit der Finanzkrise 2008/09 ist der Anteil von Bürgern mit mittleren Einkommen und Vermögen von knapp 65 auf 63 Prozent gesunken, wie es in einer Studie des Ifo-Instituts heisst. Dieser auf den ersten Blick moderate Rückgang müsse dabei im europäischen Vergleich gesehen werden: Lag Deutschlands Grösse der Mittelschicht im Jahr 2007 noch auf Rang 9 im europäischen Vergleich und somit im oberen Drittel der Verteilung, so findet sie sich im Jahr 2019 nur noch auf Platz 14 und somit im Mittelfeld der 28 betrachteten europäischen Länder wieder.
Während aber die Arbeitnehmer unter hohen Abgaben ächzen, geht es dem deutschen Staat glänzend. Für das laufende Jahr erwarten Bund, Länder und Gemeinden Steuereinnahmen von 921 Milliarden Euro. Der deutsche Staat würde damit so viel Geld einnehmen wie niemals zuvor in seiner Geschichte. Tendenz: steigend. Spätestens 2025 könnte erstmals die Billionengrenze bei den Einnahmen überschritten werden, teilte das Finanzministerium im Mai mit.
Lena Gaedke bringt dieser Kontrast mittlerweile ins Grübeln. Die 33-Jährige lebt mit ihrem sechsjährigen Sohn im niedersächsischen Nienburg. Nach dem Schulabschluss hat sie eine Friseurlehre absolviert und sich auch in den folgenden Jahren weitergebildet: Vor zwei Jahren bestand sie die Meisterprüfung. «Ich bin stolz auf den Weg, den ich gegangen bin, denn er war nicht immer einfach», erzählt sie. «Mein Sohn war ein Geschenk für mich, aber für mich war auch klar, dass ich auch in meinem Beruf vorankommen wollte.»
Und sie musste das auch. Denn die Beziehung zum Kindsvater zerbrach bald nach der Geburt, seither ist sie sowohl finanziell als auch bei der Erziehungsarbeit auf sich allein gestellt. Der Fiskus macht es ihr nicht leichter: «Netto bleibt mir ein monatliches Einkommen von gut 1600 Euro», sagt Gaedke. Zum Überleben reiche das, ein Ferienausflug hingegen werde schwierig – und ihr Traum von einer Eigentumswohnung für sich und ihren Sohn unmöglich.
«Mich wundert es, dass über die Arbeitssituation von berufstätigen Alleinerziehenden nicht viel mehr gesprochen wird.» Sie habe es für sich selbst schon einmal durchgerechnet: «Wenn ich meinen Job kündigen, zu Hause bleiben und Bürgergeld beantragen würde, wäre meine finanzielle Situation nicht viel schlechter als heute.» Im Gegenteil: Eventuell könnte sie sogar jeden Monat ein paar Euro mehr auf dem Konto haben. Eine «verrückte Vorstellung», so findet Gaedke.
Der Staat macht Freizeit günstig – und Arbeit teuer
Doch selbst wenn sich Gaedke dazu entschliessen sollte, ihre Arbeitszeit aufzustocken, und ihr Gehalt damit steigen würde, würde sich an ihrer finanziellen Situation nichts Grundlegendes ändern. Denn der Fehler liegt im System: Der deutsche Staat bestraft die Fleissigen. Das erklärt der Ökonom Friedrich Heinemann, der am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim forscht.
Deutschland sei mittlerweile das Industrieland, in dem pro Kopf die wenigsten Arbeitsstunden im Jahr erbracht würden. Schuld daran sei nicht zuletzt das Steuer- und Abgabensystem, das dazu führe, dass sich Mehrarbeit für Arbeitnehmer schlichtweg nicht mehr lohne. Beim Grundgehalt gäben sich das Finanzamt und die Sozialkassen zwar noch zurückhaltend. «Wenn aber die Arbeitszeit aufgestockt wird, führen die sogenannten Grenzabgaben zu deutlich höheren Belastungen.»
Heinemann verdeutlicht dies anhand eines Beispiels: «Wenn ein alleinstehender Durchschnittsverdiener in der Industrie eine Lohnerhöhung von 100 Euro mit seinem Arbeitgeber aushandelt, wandern lediglich 41 Euro zusätzlich in sein Portemonnaie.» Die restlichen 59 Euro werden in Form von Steuern und Sozialabgaben vom Staat einbehalten. Die Höhe der Grenzabgaben betrage somit etwa 60 Prozent, erklärt der Ökonom.
Damit nicht genug: Wenn der Arbeitnehmer die Lohnerhöhung direkt ausgibt, greift der Staat erneut über die Mehrwertsteuer zu. In einigen Fällen bleiben von einer Gehaltserhöhung um 100 Euro dann lediglich 33 Euro übrig. «Der Staat sorgt in Deutschland also dafür, dass Freizeit günstig, Arbeit hingegen teuer wird», sagt Heinemann. «Der Aufbau von Wohlstand im Land wird dadurch vom Staat aktiv verhindert.» Das belegen auch die amtlichen Daten: Seit 1990 ist die Zahl der Arbeitnehmer, die lediglich einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, explosionsartig angestiegen.
Der schrumpfende Wohlstand im Land macht sich dabei schon jetzt deutlich bemerkbar – nicht nur bei Erwerbstätigen in den unteren Einkommensschichten wie bei der Friseurmeisterin Gaedke. Sogar bis tief in die Mittelschicht hinein ist es vielen Deutschen mittlerweile nicht mehr möglich, sich elementare Lebensträume zu erfüllen – wie etwa den Erwerb einer eigenen Immobilie.
Deutschland sei im europäischen Ländervergleich «klares Schlusslicht» beim Anteil der Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden lebten, gab das Münchener Ifo-Institut in einer neuen Studie zu bedenken. Weniger als die Hälfte aller Haushalte lebten demnach jüngst in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung, während in den anderen europäischen Ländern der Mehrheit der Haushalte die Immobilie gehöre, in der sie wohnten.
Verhindert wird der Immobilienkauf für viele – und damit der Wohlstandsaufbau – nicht zuletzt vom Staat, der die Kosten in die Höhe treibt. Nach Berechnungen des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft (ZIA) sind mittlerweile fast 40 Prozent der Kaufpreise für Immobilien auf direkte staatliche Abgaben und Anforderungen zurückzuführen.
Der ZIA-Präsident Andreas Mattner gibt deshalb zu bedenken: «Explodierende Grunderwerbssteuern, Gebühren, Gewinnabschöpfungsmodelle sowie Vorgaben und Restriktionen verursachen weit mehr als ein Drittel der Kosten. Genau hier sind die Hebel, wenn eine Wende am deutschen Wohnungsmarkt realistisch sein soll.»
Wie der Staat den Immobilienerwerb seiner Bürger fördern kann, zeigen die Niederlande, wo etwa die Grunderwerbssteuer nicht pauschal sämtlichen Käufern auferlegt wird.
Wer seine Wohnimmobilie selbst nutzt, wird mit einem ermässigten Satz von 2 Prozent besteuert. Kapitalgesellschaften hingegen müssen beim Immobilienerwerb 8 Prozent auf den Tisch legen. Besonders gefördert werden zudem junge Hauskäufer: Sie sind bis zum Alter von 35 Jahren gänzlich von der Grunderwerbssteuer befreit – solange der Kaufpreis 400 000 Euro nicht übersteigt. Auch für Neubauten fällt keine Grunderwerbssteuer an.
Die Rente wackelt
Gerade eine höhere Eigentümerquote bei Immobilien wäre für die deutsche Wohlstandsentwicklung wichtig – nicht zuletzt für all jene Bürger, die ihr Erwerbsleben bereits beendet haben. Denn das gesetzliche deutsche Rentensystem stösst wegen der Gesellschaftsalterung an seine Grenzen, es muss mittlerweile mit immer neuen Steuermilliarden stabil gehalten werden. Und es reicht dennoch für viele allenfalls noch aus, um die nötigsten Bedürfnisse zu decken.
Mehr als ein Viertel aller deutschen Rentner verfügt monatlich über weniger als 1000 Euro. Das geht aus jüngsten Daten hervor, die das Statistische Bundesamt vergangene Woche vorgelegt hat. Die Senioren liegen damit sogar noch unter der amtlich definierten Armutsgrenze von 1250 Euro, was 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland entspricht. In den ersten drei Monaten des Jahres waren deshalb 684 000 Rentner auf die staatliche Grundsicherung angewiesen. Das entspricht einem Anstieg von 15 Prozent oder 90 000 Rentnern im Vergleich zum Vorjahr.
Auch hier liegt der Fehler im System: Die Politik hat bei der Altersvorsorge in den vergangenen Jahren alles auf eine Karte gesetzt: die gesetzliche Rentenversicherung. Das war eine riskante Strategie, denn die Wohlstandsvorsorge für das Alter sollte auf mehreren Säulen ruhen. «Die demografische Entwicklung und insbesondere der anstehende Renteneintritt der Babyboomer setzt die umlagefinanzierte gesetzliche Rente, die für die meisten die wichtigste Säule der Altersvorsorge ist, massiv unter Druck», sagt der Ökonom Volker Wieland. «Die Zahl der Rentenempfänger pro Beitragszahler wird deutlich und dauerhaft zunehmen.»
Die private und betriebliche Vorsorge ist in den letzten Jahrzehnten hingegen völlig in den Hintergrund getreten. Statt die Beitragssätze für die Sozialkassen in den kommenden Jahren weiter ansteigen zu lassen, sollte die Politik den Bürgern einen finanziellen Freiraum verschaffen, damit sie sich noch auf anderem Weg ein Polster für den Ruhestand anlegen können.
Der Ökonom Wieland erklärt, wie es funktionieren könnte: «Um die Rente zukunftsfähig zu machen, müsste das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben und an die Lebenserwartung angepasst werden.» Ausserdem müssten die kapitalgedeckten Renten viel stärker ausgebaut werden, das heisst, man müsste die «Riesterrente» reformieren, so dass die private Altersvorsorge viel mehr genutzt würde, das angesparte Vermögen breiter in Wertpapiere und Aktien angelegt werden könnte und die Kosten sänken. «Ebenso gilt es, die kapitalgedeckte betriebliche Altersvorsorge auszubauen.»
Als gutes Beispiel nennt Wieland Schweden. Dort fliessen 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens in kapitalmarktbasierte Produkte, die die Arbeitnehmer auswählen können. Man muss es nicht genau wie Schweden machen, aber länger zu arbeiten und die Altersvorsorge stärker über den Kapitalmarkt zu organisieren, dies sind entscheidende Schritte, um die Rente vom Kopf auf die Füsse zu stellen.
Wie es besser geht, zeigt auch die Schweiz: Hier ist die betriebliche, kapitalgedeckte Altersvorsorge obligatorisch. Und das führt auch zu einem besser ausgeglichenen Einkommensverhältnis der Bürger am Lebensabend. Während sich in Deutschland der Grossteil der Renteneinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung speist, sind sie in der Schweiz annähernd ausgeglichen.
Der positive Effekt: Der Abstand zwischen dem letzten Gehalt und der Rentenzahlung ist im Alpenland deutlich geringer, als das in Deutschland der Fall ist.
Es braucht einen wirtschaftlichen Kulturwandel
Die «deutsche Krankheit» – die wohlstandsgefährdende Belastung der Bürger durch Steuern und Abgaben – führt also schon heute zu drastischen Konsequenzen. Um die Heilung anzustossen, bedarf es dabei nicht nur des Herumschraubens an Steuersätzen und Abgabenquoten – es braucht auch einen Kulturwandel. Davon ist der Ökonom Heinemann überzeugt. In den vergangenen Jahrzehnten habe in Deutschland die Staatsgläubigkeit zugenommen. In den Gründungsjahren der Republik habe es ein anderes Verständnis dafür gegeben, welche Aufgaben dem Sozialstaat zukämen: «Ursprünglich sollten Menschen am unteren Ende der Einkommensskala zielgenau unterstützt werden.»
Inzwischen aber solle der Staat auch einspringen, um eine breite Absicherung der Mittelklasse gegen alle möglichen Risiken sicherzustellen. Damit habe sich auch das Handeln der Menschen gewandelt: «Die Bürger kennen sich inzwischen besser damit aus, wie sie einen bestimmten staatlichen Transfer beantragen, als damit, wie sie mit eigener Arbeit ihren Wohlstand selbst aufbauen können.» Anders ausgedrückt: Das Land verabschiedet sich von der Ludwig-Erhardschen Idee der sozialen Marktwirtschaft.
Auch der Arbeitgeberpräsident Dulger verliert deshalb mittlerweile die Geduld. Fast sechs Monate sind seit seiner Krisenwarnung vergangen, die eigene Erkältung ist längst auskuriert, die Heilung des deutschen Patienten allerdings lässt weiter auf sich warten. «Nun werden manche Entscheider wach – aber gehandelt wird immer noch nicht», so tadelt er die Bundesregierung.
Deutschland müsse endlich den Teufelskreis aus steigenden Steuern und Abgaben durchbrechen. Eine neue Angebotspolitik müsse die Kosten in Deutschland senken. «Wir brauchen eine staatliche Ausgabendiät. Und wir brauchen eine Sozialabgabenbremse durch ausgabensenkende Reformen in allen sozialen Sicherungssystemen», sagt er. Und fügt hinzu: «Wir müssen handeln und nicht warten, bis es zu spät ist.»
SERIE - Adieu, soziale Marktwirtschaft? Wie der deutsche Staat den Aufbau von Wohlstand verhindert
Berlin an einem kalten Abend im vergangenen Februar. Rainer Dulger sitzt in einem Restaurant im Ortsteil Charlottenburg und ist sichtlich angeschlagen: Die Nase läuft, er hustet. Doch es ist nicht das eigene Wohlbefinden, das ihn an diesem Abend umtreibt, «die Erkältung geht schon wieder vorbei», sagt er. Nein, Sorgen bereitet ihm ein anderer Patient: die Bundesrepublik Deutschland.
Der Cocktail aus Krieg, Inflation und teurer Energie sei eine heftige Mischung für das Land, gibt der Präsident der mächtigen Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an diesem Abend warnend zu bedenken. Europas grösste Volkswirtschaft drohe zum kranken Mann des Kontinents zu werden. Die Konsequenzen für die Bürger wären drastisch: Ihr Wohlstand ist in Gefahr.
Es brauche eine «klare Analyse und beherztes Handeln», damit das angeschlagene Land wieder auf die Beine komme, so appellierte Dulger daher an die Bundesregierung. Denn nicht zuletzt sie sieht er in der Pflicht: Während man ihr die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht vorwerfen könne, müsse sie sich aber der Kritik stellen, zu wenig zu unternehmen, um Bürger und Betriebe zu entlasten.
Es ist ein Vorwurf, den Wirtschaftsexperten schon lange äussern – und der jüngst von neuen Zahlen der Industrieländerorganisation OECD eindrücklich untermauert wurde. Ein Durchschnittsverdiener musste in Deutschland 2022 demnach mittlerweile beinahe jeden zweiten Euro seines Einkommens dafür aufwenden, seine Steuern zu zahlen und seine Beiträge für die Sozialversicherungen zu begleichen. Es ist ein fragwürdiger Rekord: Nur in Belgien werden Arbeitnehmer laut OECD noch stärker zur Kasse gebeten.
Wenig besser sieht die Situation für Familien aus: Im Schnitt kassierte der deutsche Staat bei einem Doppelverdiener-Paar mit Kindern im vergangenen Jahr 40,8 Prozent der Bezüge in Form von Steuern und Abgaben. Das ist weit entfernt von der durchschnittlichen Abgabenlast in anderen Industrieländern und noch weiter entfernt von Nachbarländern wie der Schweiz, wo der Staat seine Bürger mit Abgaben belastet, die im Schnitt nur halb so hoch liegen.
Vor allem die deutsche Mittelschicht trifft die hohe Kostenlast: Sie geriet in letzter Zeit unter Druck und schrumpft. Seit der Finanzkrise 2008/09 ist der Anteil von Bürgern mit mittleren Einkommen und Vermögen von knapp 65 auf 63 Prozent gesunken, wie es in einer Studie des Ifo-Instituts heisst. Dieser auf den ersten Blick moderate Rückgang müsse dabei im europäischen Vergleich gesehen werden: Lag Deutschlands Grösse der Mittelschicht im Jahr 2007 noch auf Rang 9 im europäischen Vergleich und somit im oberen Drittel der Verteilung, so findet sie sich im Jahr 2019 nur noch auf Platz 14 und somit im Mittelfeld der 28 betrachteten europäischen Länder wieder.
Während aber die Arbeitnehmer unter hohen Abgaben ächzen, geht es dem deutschen Staat glänzend. Für das laufende Jahr erwarten Bund, Länder und Gemeinden Steuereinnahmen von 921 Milliarden Euro. Der deutsche Staat würde damit so viel Geld einnehmen wie niemals zuvor in seiner Geschichte. Tendenz: steigend. Spätestens 2025 könnte erstmals die Billionengrenze bei den Einnahmen überschritten werden, teilte das Finanzministerium im Mai mit.
Lena Gaedke bringt dieser Kontrast mittlerweile ins Grübeln. Die 33-Jährige lebt mit ihrem sechsjährigen Sohn im niedersächsischen Nienburg. Nach dem Schulabschluss hat sie eine Friseurlehre absolviert und sich auch in den folgenden Jahren weitergebildet: Vor zwei Jahren bestand sie die Meisterprüfung. «Ich bin stolz auf den Weg, den ich gegangen bin, denn er war nicht immer einfach», erzählt sie. «Mein Sohn war ein Geschenk für mich, aber für mich war auch klar, dass ich auch in meinem Beruf vorankommen wollte.»
Und sie musste das auch. Denn die Beziehung zum Kindsvater zerbrach bald nach der Geburt, seither ist sie sowohl finanziell als auch bei der Erziehungsarbeit auf sich allein gestellt. Der Fiskus macht es ihr nicht leichter: «Netto bleibt mir ein monatliches Einkommen von gut 1600 Euro», sagt Gaedke. Zum Überleben reiche das, ein Ferienausflug hingegen werde schwierig – und ihr Traum von einer Eigentumswohnung für sich und ihren Sohn unmöglich.
«Mich wundert es, dass über die Arbeitssituation von berufstätigen Alleinerziehenden nicht viel mehr gesprochen wird.» Sie habe es für sich selbst schon einmal durchgerechnet: «Wenn ich meinen Job kündigen, zu Hause bleiben und Bürgergeld beantragen würde, wäre meine finanzielle Situation nicht viel schlechter als heute.» Im Gegenteil: Eventuell könnte sie sogar jeden Monat ein paar Euro mehr auf dem Konto haben. Eine «verrückte Vorstellung», so findet Gaedke.
Der Staat macht Freizeit günstig – und Arbeit teuer
Doch selbst wenn sich Gaedke dazu entschliessen sollte, ihre Arbeitszeit aufzustocken, und ihr Gehalt damit steigen würde, würde sich an ihrer finanziellen Situation nichts Grundlegendes ändern. Denn der Fehler liegt im System: Der deutsche Staat bestraft die Fleissigen. Das erklärt der Ökonom Friedrich Heinemann, der am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim forscht.
Deutschland sei mittlerweile das Industrieland, in dem pro Kopf die wenigsten Arbeitsstunden im Jahr erbracht würden. Schuld daran sei nicht zuletzt das Steuer- und Abgabensystem, das dazu führe, dass sich Mehrarbeit für Arbeitnehmer schlichtweg nicht mehr lohne. Beim Grundgehalt gäben sich das Finanzamt und die Sozialkassen zwar noch zurückhaltend. «Wenn aber die Arbeitszeit aufgestockt wird, führen die sogenannten Grenzabgaben zu deutlich höheren Belastungen.»
Heinemann verdeutlicht dies anhand eines Beispiels: «Wenn ein alleinstehender Durchschnittsverdiener in der Industrie eine Lohnerhöhung von 100 Euro mit seinem Arbeitgeber aushandelt, wandern lediglich 41 Euro zusätzlich in sein Portemonnaie.» Die restlichen 59 Euro werden in Form von Steuern und Sozialabgaben vom Staat einbehalten. Die Höhe der Grenzabgaben betrage somit etwa 60 Prozent, erklärt der Ökonom.
Damit nicht genug: Wenn der Arbeitnehmer die Lohnerhöhung direkt ausgibt, greift der Staat erneut über die Mehrwertsteuer zu. In einigen Fällen bleiben von einer Gehaltserhöhung um 100 Euro dann lediglich 33 Euro übrig. «Der Staat sorgt in Deutschland also dafür, dass Freizeit günstig, Arbeit hingegen teuer wird», sagt Heinemann. «Der Aufbau von Wohlstand im Land wird dadurch vom Staat aktiv verhindert.» Das belegen auch die amtlichen Daten: Seit 1990 ist die Zahl der Arbeitnehmer, die lediglich einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, explosionsartig angestiegen.
Der schrumpfende Wohlstand im Land macht sich dabei schon jetzt deutlich bemerkbar – nicht nur bei Erwerbstätigen in den unteren Einkommensschichten wie bei der Friseurmeisterin Gaedke. Sogar bis tief in die Mittelschicht hinein ist es vielen Deutschen mittlerweile nicht mehr möglich, sich elementare Lebensträume zu erfüllen – wie etwa den Erwerb einer eigenen Immobilie.
Deutschland sei im europäischen Ländervergleich «klares Schlusslicht» beim Anteil der Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden lebten, gab das Münchener Ifo-Institut in einer neuen Studie zu bedenken. Weniger als die Hälfte aller Haushalte lebten demnach jüngst in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung, während in den anderen europäischen Ländern der Mehrheit der Haushalte die Immobilie gehöre, in der sie wohnten.
Verhindert wird der Immobilienkauf für viele – und damit der Wohlstandsaufbau – nicht zuletzt vom Staat, der die Kosten in die Höhe treibt. Nach Berechnungen des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft (ZIA) sind mittlerweile fast 40 Prozent der Kaufpreise für Immobilien auf direkte staatliche Abgaben und Anforderungen zurückzuführen.
Der ZIA-Präsident Andreas Mattner gibt deshalb zu bedenken: «Explodierende Grunderwerbssteuern, Gebühren, Gewinnabschöpfungsmodelle sowie Vorgaben und Restriktionen verursachen weit mehr als ein Drittel der Kosten. Genau hier sind die Hebel, wenn eine Wende am deutschen Wohnungsmarkt realistisch sein soll.»
Wie der Staat den Immobilienerwerb seiner Bürger fördern kann, zeigen die Niederlande, wo etwa die Grunderwerbssteuer nicht pauschal sämtlichen Käufern auferlegt wird.
Wer seine Wohnimmobilie selbst nutzt, wird mit einem ermässigten Satz von 2 Prozent besteuert. Kapitalgesellschaften hingegen müssen beim Immobilienerwerb 8 Prozent auf den Tisch legen. Besonders gefördert werden zudem junge Hauskäufer: Sie sind bis zum Alter von 35 Jahren gänzlich von der Grunderwerbssteuer befreit – solange der Kaufpreis 400 000 Euro nicht übersteigt. Auch für Neubauten fällt keine Grunderwerbssteuer an.
Die Rente wackelt
Gerade eine höhere Eigentümerquote bei Immobilien wäre für die deutsche Wohlstandsentwicklung wichtig – nicht zuletzt für all jene Bürger, die ihr Erwerbsleben bereits beendet haben. Denn das gesetzliche deutsche Rentensystem stösst wegen der Gesellschaftsalterung an seine Grenzen, es muss mittlerweile mit immer neuen Steuermilliarden stabil gehalten werden. Und es reicht dennoch für viele allenfalls noch aus, um die nötigsten Bedürfnisse zu decken.
Mehr als ein Viertel aller deutschen Rentner verfügt monatlich über weniger als 1000 Euro. Das geht aus jüngsten Daten hervor, die das Statistische Bundesamt vergangene Woche vorgelegt hat. Die Senioren liegen damit sogar noch unter der amtlich definierten Armutsgrenze von 1250 Euro, was 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland entspricht. In den ersten drei Monaten des Jahres waren deshalb 684 000 Rentner auf die staatliche Grundsicherung angewiesen. Das entspricht einem Anstieg von 15 Prozent oder 90 000 Rentnern im Vergleich zum Vorjahr.
Auch hier liegt der Fehler im System: Die Politik hat bei der Altersvorsorge in den vergangenen Jahren alles auf eine Karte gesetzt: die gesetzliche Rentenversicherung. Das war eine riskante Strategie, denn die Wohlstandsvorsorge für das Alter sollte auf mehreren Säulen ruhen. «Die demografische Entwicklung und insbesondere der anstehende Renteneintritt der Babyboomer setzt die umlagefinanzierte gesetzliche Rente, die für die meisten die wichtigste Säule der Altersvorsorge ist, massiv unter Druck», sagt der Ökonom Volker Wieland. «Die Zahl der Rentenempfänger pro Beitragszahler wird deutlich und dauerhaft zunehmen.»
Die private und betriebliche Vorsorge ist in den letzten Jahrzehnten hingegen völlig in den Hintergrund getreten. Statt die Beitragssätze für die Sozialkassen in den kommenden Jahren weiter ansteigen zu lassen, sollte die Politik den Bürgern einen finanziellen Freiraum verschaffen, damit sie sich noch auf anderem Weg ein Polster für den Ruhestand anlegen können.
Der Ökonom Wieland erklärt, wie es funktionieren könnte: «Um die Rente zukunftsfähig zu machen, müsste das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben und an die Lebenserwartung angepasst werden.» Ausserdem müssten die kapitalgedeckten Renten viel stärker ausgebaut werden, das heisst, man müsste die «Riesterrente» reformieren, so dass die private Altersvorsorge viel mehr genutzt würde, das angesparte Vermögen breiter in Wertpapiere und Aktien angelegt werden könnte und die Kosten sänken. «Ebenso gilt es, die kapitalgedeckte betriebliche Altersvorsorge auszubauen.»
Als gutes Beispiel nennt Wieland Schweden. Dort fliessen 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens in kapitalmarktbasierte Produkte, die die Arbeitnehmer auswählen können. Man muss es nicht genau wie Schweden machen, aber länger zu arbeiten und die Altersvorsorge stärker über den Kapitalmarkt zu organisieren, dies sind entscheidende Schritte, um die Rente vom Kopf auf die Füsse zu stellen.
Wie es besser geht, zeigt auch die Schweiz: Hier ist die betriebliche, kapitalgedeckte Altersvorsorge obligatorisch. Und das führt auch zu einem besser ausgeglichenen Einkommensverhältnis der Bürger am Lebensabend. Während sich in Deutschland der Grossteil der Renteneinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung speist, sind sie in der Schweiz annähernd ausgeglichen.
Der positive Effekt: Der Abstand zwischen dem letzten Gehalt und der Rentenzahlung ist im Alpenland deutlich geringer, als das in Deutschland der Fall ist.
Es braucht einen wirtschaftlichen Kulturwandel
Die «deutsche Krankheit» – die wohlstandsgefährdende Belastung der Bürger durch Steuern und Abgaben – führt also schon heute zu drastischen Konsequenzen. Um die Heilung anzustossen, bedarf es dabei nicht nur des Herumschraubens an Steuersätzen und Abgabenquoten – es braucht auch einen Kulturwandel. Davon ist der Ökonom Heinemann überzeugt. In den vergangenen Jahrzehnten habe in Deutschland die Staatsgläubigkeit zugenommen. In den Gründungsjahren der Republik habe es ein anderes Verständnis dafür gegeben, welche Aufgaben dem Sozialstaat zukämen: «Ursprünglich sollten Menschen am unteren Ende der Einkommensskala zielgenau unterstützt werden.»
Inzwischen aber solle der Staat auch einspringen, um eine breite Absicherung der Mittelklasse gegen alle möglichen Risiken sicherzustellen. Damit habe sich auch das Handeln der Menschen gewandelt: «Die Bürger kennen sich inzwischen besser damit aus, wie sie einen bestimmten staatlichen Transfer beantragen, als damit, wie sie mit eigener Arbeit ihren Wohlstand selbst aufbauen können.» Anders ausgedrückt: Das Land verabschiedet sich von der Ludwig-Erhardschen Idee der sozialen Marktwirtschaft.
Auch der Arbeitgeberpräsident Dulger verliert deshalb mittlerweile die Geduld. Fast sechs Monate sind seit seiner Krisenwarnung vergangen, die eigene Erkältung ist längst auskuriert, die Heilung des deutschen Patienten allerdings lässt weiter auf sich warten. «Nun werden manche Entscheider wach – aber gehandelt wird immer noch nicht», so tadelt er die Bundesregierung.
Deutschland müsse endlich den Teufelskreis aus steigenden Steuern und Abgaben durchbrechen. Eine neue Angebotspolitik müsse die Kosten in Deutschland senken. «Wir brauchen eine staatliche Ausgabendiät. Und wir brauchen eine Sozialabgabenbremse durch ausgabensenkende Reformen in allen sozialen Sicherungssystemen», sagt er. Und fügt hinzu: «Wir müssen handeln und nicht warten, bis es zu spät ist.»
Zitat von Gast am 20. Juli 2023, 13:34 UhrDeutsche Wirtschaft stellt Ampel vernichtendes Zeugnis aus - Habeck stürzt ab
Schlimmer als Merkel-Regierung
Deutsche Wirtschaft stellt Ampel vernichtendes Zeugnis aus - Habeck stürzt ab
Ein Mal im Jahr beurteilen führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung im Elite-Panel die Arbeit der Bundesregierung. In diesem Jahr fällt das Zeugnis vernichtend aus.
Berlin – Deutschlands Top-Manager und Unternehmer sind der Meinung, dass Deutschland seine besten Jahre hinter sich hat – und dass es ab jetzt wirtschaftlich eher abwärts gehen wird. Das zeigt das Ergebnis des diesjährigen Elite-Panels, das das Meinungsforschungsinstitut Allensbach jedes Jahr im Auftrag der FAZ durchführt. Dabei werden rund 500 Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu aktuellen Themen befragt.
So denken 58 Prozent der Wirtschaftsvertreter, dass Deutschland seinen Zenit überschritten hat. 63 Prozent der befragten Politiker halten diese Einschätzung für „zu pessimistisch“. Seit Sommer 2022 denken die meisten Befragten, dass sich die deutsche Konjunktur in einem Abwärtstrend befindet – nur 22 Prozent glauben im Juni 2023 noch, dass es wieder aufwärtsgehen wird. Damit ist das Ansehen der Ampel-Koalition schon zur Halbzeit der Legislatur schlechter als das der letzten Merkel-Koalition im Jahr 2019.
Grüne Minister stürzen ab
Besonders verheerend fällt das Urteil für die beiden Grünen-Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck aus. So haben noch vor einem Jahr 91 Prozent der Befragten beiden Ministern eine gute Arbeit bescheinigt. In diesem Jahr fällt die Außenministerin auf 49 Prozent hinab, Wirtschaftsminister Habeck kracht sogar auf gerade mal 24 Prozent, die seine Arbeit noch gut finden. Am besten schneidet der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ab, dem 95 Prozent zusprechen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) verzeichnet einen leichten, aber stetigen Aufstieg von 43 Prozent vor einem Jahr auf 65 Prozent aktuell.
Die befragten Wirtschaftsvertreter sehen außerdem eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Koalition. Im Juni 2022 haben 73 Prozent gesagt, dass die Grünen die dominierende Kraft innerhalb der Ampel-Koalition seien. Im Juli 2023 sehen nur noch 42 Prozent der Befragten so, während 18 Prozent die SPD und 17 Prozent die FDP als dominante Partei ansehen. 22 Prozent finden, dass keine der drei Koalitionspartner die Dominante ist.
Insgesamt fällt das Urteil über die Koalition vernichtend aus: 76 Prozent der Befragten geben an, dass die Bundesregierung mit ihrer aktuellen Politik das Land schwächt.
Deutschland steht laut Befragten vor Deindustrialisierung
Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zeichnen die Führungsspitzen ein düsteres Bild. So glauben 69 Prozent der Befragten, dass die Sorge um eine Deindustrialisierung in Deutschland realistisch ist. Nur 17 Prozent glauben, dass Deutschland in der Lage sein wird, seine Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen.
Erstaunlicherweise sprechen sich angesichts dieser Umstände nur 52 Prozent der Führungsspitzen für einen Industriestrompreis aus – weit weniger als man vermuten könnte, wenn man die lauten Forderungen nach einem subventionierten Strompreis vonseiten der Verbände und großen Konzerne hört.
Insgesamt sind dreiviertel der Befragten unzufrieden mit der Energiepolitik der Ampel-Koalition. 53 Prozent der Entscheidungsträger äußerten die Sorge, dass die Stromversorgung in Zukunft nicht mehr verlässlich gedeckt werden kann. Dennoch gibt es auch einen Lichtblick für die Bundesregierung: Immerhin glauben fast 50 Prozent der Befragten, dass das versprochene grüne Wirtschaftswunder Realität werden kann.
Deutsche Wirtschaft stellt Ampel vernichtendes Zeugnis aus - Habeck stürzt ab
Schlimmer als Merkel-Regierung
Deutsche Wirtschaft stellt Ampel vernichtendes Zeugnis aus - Habeck stürzt ab
Ein Mal im Jahr beurteilen führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung im Elite-Panel die Arbeit der Bundesregierung. In diesem Jahr fällt das Zeugnis vernichtend aus.
Berlin – Deutschlands Top-Manager und Unternehmer sind der Meinung, dass Deutschland seine besten Jahre hinter sich hat – und dass es ab jetzt wirtschaftlich eher abwärts gehen wird. Das zeigt das Ergebnis des diesjährigen Elite-Panels, das das Meinungsforschungsinstitut Allensbach jedes Jahr im Auftrag der FAZ durchführt. Dabei werden rund 500 Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu aktuellen Themen befragt.
So denken 58 Prozent der Wirtschaftsvertreter, dass Deutschland seinen Zenit überschritten hat. 63 Prozent der befragten Politiker halten diese Einschätzung für „zu pessimistisch“. Seit Sommer 2022 denken die meisten Befragten, dass sich die deutsche Konjunktur in einem Abwärtstrend befindet – nur 22 Prozent glauben im Juni 2023 noch, dass es wieder aufwärtsgehen wird. Damit ist das Ansehen der Ampel-Koalition schon zur Halbzeit der Legislatur schlechter als das der letzten Merkel-Koalition im Jahr 2019.
Grüne Minister stürzen ab
Besonders verheerend fällt das Urteil für die beiden Grünen-Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck aus. So haben noch vor einem Jahr 91 Prozent der Befragten beiden Ministern eine gute Arbeit bescheinigt. In diesem Jahr fällt die Außenministerin auf 49 Prozent hinab, Wirtschaftsminister Habeck kracht sogar auf gerade mal 24 Prozent, die seine Arbeit noch gut finden. Am besten schneidet der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ab, dem 95 Prozent zusprechen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) verzeichnet einen leichten, aber stetigen Aufstieg von 43 Prozent vor einem Jahr auf 65 Prozent aktuell.
Die befragten Wirtschaftsvertreter sehen außerdem eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Koalition. Im Juni 2022 haben 73 Prozent gesagt, dass die Grünen die dominierende Kraft innerhalb der Ampel-Koalition seien. Im Juli 2023 sehen nur noch 42 Prozent der Befragten so, während 18 Prozent die SPD und 17 Prozent die FDP als dominante Partei ansehen. 22 Prozent finden, dass keine der drei Koalitionspartner die Dominante ist.
Insgesamt fällt das Urteil über die Koalition vernichtend aus: 76 Prozent der Befragten geben an, dass die Bundesregierung mit ihrer aktuellen Politik das Land schwächt.
Deutschland steht laut Befragten vor Deindustrialisierung
Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zeichnen die Führungsspitzen ein düsteres Bild. So glauben 69 Prozent der Befragten, dass die Sorge um eine Deindustrialisierung in Deutschland realistisch ist. Nur 17 Prozent glauben, dass Deutschland in der Lage sein wird, seine Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen.
Erstaunlicherweise sprechen sich angesichts dieser Umstände nur 52 Prozent der Führungsspitzen für einen Industriestrompreis aus – weit weniger als man vermuten könnte, wenn man die lauten Forderungen nach einem subventionierten Strompreis vonseiten der Verbände und großen Konzerne hört.
Insgesamt sind dreiviertel der Befragten unzufrieden mit der Energiepolitik der Ampel-Koalition. 53 Prozent der Entscheidungsträger äußerten die Sorge, dass die Stromversorgung in Zukunft nicht mehr verlässlich gedeckt werden kann. Dennoch gibt es auch einen Lichtblick für die Bundesregierung: Immerhin glauben fast 50 Prozent der Befragten, dass das versprochene grüne Wirtschaftswunder Realität werden kann.
Zitat von Gast am 24. Juli 2023, 05:25 UhrDer Himmel ist nicht rosarot: Habeck legt harte Landung hin
Der Kernfehler der Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik: Sie agiert, als hätte sie einen Plan. Sie will nichts weniger als die Rettung der Welt respektive des Klimas. Von dorther wird alles gedacht. Die Umsetzung beruht auf der Illusion, der Staat könne zunächst festlegen, was die Konsumenten wollen dürfen. Er könne dann die Industrie beauftragen, diese Waren zu produzieren. Und schließlich könne man diesen ewigen Kreislauf mit Subventions-Milliarden am Laufen halten. Grundsätzlich ist es natürlich lobenswert, wenn eine Regierung hohe Ziele hat. Es steht außer Frage, dass die Gesellschaften sich auf den Klimawandel einstellen müssen. Da gibt es genug zu tun. Viele Dinge sollten unverzüglich geschehen, sofort. Doch der vermeintliche „Plan“ der Regierung – die Rettung der Welt – kann nicht operativ umgesetzt werden.
Die Rettung der Welt ist vielmehr ein Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es einen Plan. Und der muss so konkret und umsetzbar sein, dass er etwas bringt und die Leute nicht auf der Hälfte des Weges der Regierung die Gefolgschaft verweigern. Genau diese Gefahr besteht jetzt: Die Bewertungen der bisherigen Maßnahmen der Regierung zur Rettung der Welt und des Klimas reichen von bescheiden bis desaströs. Bescheiden ist der Ausbau der Windkraft.
Laut der aktuellen Zahlen liegt die Bundesregierung weit hinter den Ausbauplänen bei Windrädern. Der Grund sind nicht, wie von der Wind-Lobby gerne vorgetragen, die unwilligen Bürger, die sich gegen die Industrieanlagen vor ihrer Haustür wehren. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat soeben den geplanten Bau eines großen Windparks in der Nordsee vor der britischen Küste gestoppt. Die Vattenfall-Chefin Anna Borg erklärte zur Begründung, die Investitionskosten seien gestiegen, die Lieferketten seien unter Druck und die steuerlichen Rahmenbedingungen entsprächen nicht den „aktuellen Realitäten des Marktes“. Die Windkraft sei zwar enorm wichtig für sauberen, sicheren und bezahlbaren Strom – die Bedingungen seien aber aktuell „extrem schwierig“.
Das sagt die Chefin eines Konzerns, der sich schon vor Jahren massiv in Richtung der Erneuerbaren bewegt hat. Die Gesetze des Marktes gelten für alle, sie können auch von einer noch so wild entschlossenen Regierung nicht ausgehebelt werden: Wenn sich bestimmte Anlagen nicht rechnen, dann baut sie keiner. Die Regierung kann das niemandem befehlen, außer sie steckt Milliarden in den Aufbau staatlicher Unternehmen. Bis die jedoch stehen, ist die deutsche Wirtschaft am Ende.
Ähnlich bescheiden sind die bisher realisierten Schritte in Richtung Wasserstoff, Solar und Batterien. Hier hat die Bundesregierung in bemerkenswerter Hilflosigkeit zugesehen, wie die US-Regierung mit dem Inflation Reduction Act (IRA) Unternehmen aus aller Welt abwirbt, während Chinas Staatskapitalisten ihrerseits gegen die amerikanischen Wettbewerber antreten.
Wie sehr die Bundesregierung mit dem Rücken zur Wand steht, belegt eine Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Dieser sagte auf seiner Indien-Reise in Mumbai, über die Einführung eines staatlich subventionierten niedrigeren Industriestrompreises werde sicherlich über den Sommer noch viel geredet werden: „Aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr. Wenn wir nur noch lange reden, dann machen die Unternehmen ihre eigenen Entscheidungen und die werden dann nicht mehr für den Standort Deutschland sein.“
Habeck will mit staatlichen Milliarden-Hilfen im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie ermöglichen. Er will dazu den Corona-Fonds einfach umwidmen: Der in der Pandemie errichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wurde dazu in der Energiekrise reaktiviert, um deren Folgen abzufedern. Die Energiekrise wiederum kam daher, dass die Bundesregierung nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine entschied, kein russisches Gas mehr für den deutschen Markt zuzulassen. Anders als andere EU-Länder wie Österreich oder Ungarn hat die Bundesregierung die EU-Marschrichtung konsequent durchgezogen. Zugleich stieg Deutschland aus der Kernenergie aus – wofür es durchaus gute Gründe gegeben haben mag.
Doch sind die Folgen dieser Politik zumindest der Rettung des Weltklimas abträglich: Denn die Industrie wandert ab und produziert anderswo. In Deutschland dagegen droht die Deindustrialisierung. Das US-Magazin Politico analysierte kürzlich die Lage und sparte nicht mit apokalyptischen Bildern – die deutsche Zukunft betreffend. Es ist Zeit für einen Plan B.
Der Himmel ist nicht rosarot: Habeck legt harte Landung hin
Der Kernfehler der Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik: Sie agiert, als hätte sie einen Plan. Sie will nichts weniger als die Rettung der Welt respektive des Klimas. Von dorther wird alles gedacht. Die Umsetzung beruht auf der Illusion, der Staat könne zunächst festlegen, was die Konsumenten wollen dürfen. Er könne dann die Industrie beauftragen, diese Waren zu produzieren. Und schließlich könne man diesen ewigen Kreislauf mit Subventions-Milliarden am Laufen halten. Grundsätzlich ist es natürlich lobenswert, wenn eine Regierung hohe Ziele hat. Es steht außer Frage, dass die Gesellschaften sich auf den Klimawandel einstellen müssen. Da gibt es genug zu tun. Viele Dinge sollten unverzüglich geschehen, sofort. Doch der vermeintliche „Plan“ der Regierung – die Rettung der Welt – kann nicht operativ umgesetzt werden.
Die Rettung der Welt ist vielmehr ein Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es einen Plan. Und der muss so konkret und umsetzbar sein, dass er etwas bringt und die Leute nicht auf der Hälfte des Weges der Regierung die Gefolgschaft verweigern. Genau diese Gefahr besteht jetzt: Die Bewertungen der bisherigen Maßnahmen der Regierung zur Rettung der Welt und des Klimas reichen von bescheiden bis desaströs. Bescheiden ist der Ausbau der Windkraft.
Laut der aktuellen Zahlen liegt die Bundesregierung weit hinter den Ausbauplänen bei Windrädern. Der Grund sind nicht, wie von der Wind-Lobby gerne vorgetragen, die unwilligen Bürger, die sich gegen die Industrieanlagen vor ihrer Haustür wehren. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat soeben den geplanten Bau eines großen Windparks in der Nordsee vor der britischen Küste gestoppt. Die Vattenfall-Chefin Anna Borg erklärte zur Begründung, die Investitionskosten seien gestiegen, die Lieferketten seien unter Druck und die steuerlichen Rahmenbedingungen entsprächen nicht den „aktuellen Realitäten des Marktes“. Die Windkraft sei zwar enorm wichtig für sauberen, sicheren und bezahlbaren Strom – die Bedingungen seien aber aktuell „extrem schwierig“.
Das sagt die Chefin eines Konzerns, der sich schon vor Jahren massiv in Richtung der Erneuerbaren bewegt hat. Die Gesetze des Marktes gelten für alle, sie können auch von einer noch so wild entschlossenen Regierung nicht ausgehebelt werden: Wenn sich bestimmte Anlagen nicht rechnen, dann baut sie keiner. Die Regierung kann das niemandem befehlen, außer sie steckt Milliarden in den Aufbau staatlicher Unternehmen. Bis die jedoch stehen, ist die deutsche Wirtschaft am Ende.
Ähnlich bescheiden sind die bisher realisierten Schritte in Richtung Wasserstoff, Solar und Batterien. Hier hat die Bundesregierung in bemerkenswerter Hilflosigkeit zugesehen, wie die US-Regierung mit dem Inflation Reduction Act (IRA) Unternehmen aus aller Welt abwirbt, während Chinas Staatskapitalisten ihrerseits gegen die amerikanischen Wettbewerber antreten.
Wie sehr die Bundesregierung mit dem Rücken zur Wand steht, belegt eine Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Dieser sagte auf seiner Indien-Reise in Mumbai, über die Einführung eines staatlich subventionierten niedrigeren Industriestrompreises werde sicherlich über den Sommer noch viel geredet werden: „Aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr. Wenn wir nur noch lange reden, dann machen die Unternehmen ihre eigenen Entscheidungen und die werden dann nicht mehr für den Standort Deutschland sein.“
Habeck will mit staatlichen Milliarden-Hilfen im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie ermöglichen. Er will dazu den Corona-Fonds einfach umwidmen: Der in der Pandemie errichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wurde dazu in der Energiekrise reaktiviert, um deren Folgen abzufedern. Die Energiekrise wiederum kam daher, dass die Bundesregierung nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine entschied, kein russisches Gas mehr für den deutschen Markt zuzulassen. Anders als andere EU-Länder wie Österreich oder Ungarn hat die Bundesregierung die EU-Marschrichtung konsequent durchgezogen. Zugleich stieg Deutschland aus der Kernenergie aus – wofür es durchaus gute Gründe gegeben haben mag.
Doch sind die Folgen dieser Politik zumindest der Rettung des Weltklimas abträglich: Denn die Industrie wandert ab und produziert anderswo. In Deutschland dagegen droht die Deindustrialisierung. Das US-Magazin Politico analysierte kürzlich die Lage und sparte nicht mit apokalyptischen Bildern – die deutsche Zukunft betreffend. Es ist Zeit für einen Plan B.
Zitat von Gast am 24. Juli 2023, 06:15 UhrGroßer Fonds mit geringer Wirkung?: Mega-Nebenhaushalt als Wollmilchsau
Die Ampel hat den sogenannten Klima- und Transformationsfonds als wichtiges Finanzierungsinstrument ausgestaltet. Aber ist er wirklich gut aufgestellt? Oder gibt es Risiken?
Die Ampel mag sich nach außen über einen Sparhaushalt streiten. Aber nebenbei hat sie sich richtig viel Geld zur Seite gelegt. Denn neben dem Bundeshaushalt führt sie ihre Sondervermögen, auch Nebenhaushalte genannt. Der für die Bundeswehr ist recht bekannt – und einfach zu verstehen, weil präzise definiert: Es geht um die Finanzierung großer Wehrausgaben über mehrere Jahre, 100 Milliarden Euro liegen in dem Fonds.
Der KTF ist weniger bekannt. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Klima- und Transformationsfonds. Der war schon 2011 eingerichtet worden, damals noch als Energie- und Klimafonds (EKF), um Ausgabenprogramme in diesem Bereich zu bündeln. Er hatte lange ein eher überschaubares Volumen.
Die Ampel jedoch hat daraus ein großes Ding gemacht und den umgetauften Fonds mit erheblich mehr Mitteln ausgestattet – aber auch sehr vielen Aufgaben. 60 Milliarden Euro auf einen Schlag gab es gleich bei Amtsantritt im Dezember 2021 über die Weiterbuchung von nicht genutzten Kreditermächtigungen für Corona-Programme aus Groko-Zeiten.
Mehr als 100 Milliarden Euro können derzeit über den KTF bewegt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen bis ins Jahr 2024 summieren sich auf 128 Milliarden Euro. Wobei die tatsächlichen Ausgaben sich nach dem aktuellen Wirtschaftsplan für 2023 auf etwa 36 Milliarden Euro belaufen sollen. Das „Ist“ im Jahr davor betrug 28 Milliarden.
Was die Ampel für 2024 konkret plant, ist noch unklar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) arbeitet derzeit am neuen Wirtschaftsplan, der in den nächsten drei Wochen fertiggestellt werden soll.
Neuerdings wird der Nebenetat zu einer Art eierlegenden Wollmilchsau der Koalition umfunktioniert, da er immer mehr Zwecken dienen soll. Weiterhin sind zwar Ausgaben für Klimapolitik im Mittelpunkt, aber die Umwidmung mit dem Begriff „Transformation“ erweitert den Spielraum. Als sich die Regierung unlängst darauf verständigte, der Bahn 45 Milliarden Euro für Investitionen zu geben, wurden 15 Milliarden davon über einen Zeitraum von zwei Jahren im KTF gebucht – im regulären Etat war das Geld nicht aufzubringen.
Milliarden für Intel
Und als sich die Ampel entschloss, dem US-Halbleiterriesen Intel für sein Magdeburger Werk noch einen Schluck mehr an Subventionen zu gönnen, wurde das als Transformationsausgabe deklariert und ein Posten von drei Milliarden Euro im KTF eingerichtet. Plus etwa vier Milliarden für die weitere Förderung von Mikroelektronik.
„Die Halbleiterproduktion hat eine hohe Relevanz für klimaneutrale Technologien und ist damit für eine erfolgreiche Transformation der deutschen Wirtschaft hin zur Klimaneutralität von großer Bedeutung“, heißt es im Etatentwurf 2024 zur Begründung. In jedem Fall macht das in den Einzeletats, vor allem im Wirtschaftsministerium, Mittel frei für andere Zwecke.
Förderung für Heizungsumbau
Auch die Förderung für neue Heizungen in privaten Häusern, unlängst mit dem Gebäudeenergiegesetz beschlossen, soll über den KTF laufen. Von zehn Milliarden Euro ist zum Auftakt die Rede. Hier allerdings knüpft die Ampel an bisherigen Maßnahmen mit derselben Stoßrichtung an: die energetische Gebäudesanierung vor allem und die Verbesserung der Energieeffizienz.
Weitere Schwerpunkte sind der Ausbau der E-Mobilität samt Ladeinfrastruktur, der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und die Förderung erneuerbarer Energien. Entsprechend groß ist die Programmvielfalt im KTF mittlerweile. Bisher aber wurde mehr gekleckert als geklotzt.
Dabei ist der Nebenhaushalt nicht nur ein Vehikel, das mit sehr viel Geld und sehr vielen Fördermaßnahmen ausgestattet ist. Es steckte von Beginn an auch viel Luft in dem großen Beutel. Bei mehreren Programmen war die Nachfrage nämlich oft geringer als das Angebot. Mittel flossen daher nicht ab, sondern quasi in die Rücklage, die weitgehend aus Kreditermächtigungen besteht. Dass Habeck unlängst andeutete, es gebe Mittel für die Heizungsförderung via KTF, hängt damit zusammen.
Kaufprämie oder Infrastruktur?
Wie effizient diese Programme sind, ist umstritten. Beispiel E-Autos: Die über EKF und KTF finanzierte Kaufprämie für E-Autos war eher ein Mitnahmeeffekt beim Erwerb teurer Wagen als eine Anschubfinanzierung für eine E-Wende am Automarkt. Die parallele Förderung der Ladeinfrastruktur hatte nicht den Effekt, ein dichteres Netz auf den Weg zu bringen. Sie wird nun erhöht, die Kaufprämie dagegen läuft aus – eine Reaktion auf eine verfehlte Förderpolitik in den vergangenen Jahren.
Finanziert wird der KTF zu einem Teil über laufende Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung (Soll 2023: 8,6 Milliarden Euro) und Erlösen aus dem EU-Emissionshandel (7,3 Milliarden). Aber der Großteil des KTF-Volumens stammt weiterhin aus der 60-Milliarden-Transaktion. Gegen die hat die Unionsfraktion im Bundestag vor dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Die mündliche Verhandlung war im Juni, eine Entscheidung dürfte im Herbst fallen.
Sollten die Richter das Vorgehen der Ampel als verfassungswidrig einstufen, hätte die Koalition ein massives Geldproblem im KTF. Nach dem Wirtschaftsplan 2023 ist nur knapp die Hälfte der Ausgaben durch Einnahmen aus dem Emissionshandel und dem CO₂-Preis gedeckt.
Entscheidung aus Karlsruhe
Sollten die Richter gnädig sein, könnte es auch auf eine Entscheidung hinauslaufen, die dem KTF strikte Beschränkungen auferlegt. Ähnlich wie das Sondervermögen Bundeswehr und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem die Energiepreisbremsen finanziert werden, müsste die Ampel dann auch den KTF gesetzlich weniger flexibel ausgestalten.
Um dem KTF mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, plant die Ampel, den CO₂-Preis ab dem nächsten Jahr wieder zu erhöhen. Wie hoch der Preis dann aber tatsächlich ausfällt, hat sie noch nicht entschieden. Dies sei „Gegenstand von Beratungen“, heißt es im Bundesfinanzministerium.
Die Regierung hatte wegen der hohen Energiepreise die eigentlich vorgesehene Erhöhung des CO₂-Preises im nationalen Emissionshandel ausgesetzt. Ginge sie auf den ursprünglichen Preispfad zurück, würde der Preis ab 2024 bei 45 Euro pro Tonne liegen. Das würde Mehreinnahmen in Höhe von rund 12 Milliarden Euro in den KTF spülen. Bei 35 Euro lägen die Mehreinnahmen rund 2,6 Milliarden Euro niedriger.
Nach Ansicht des Klimaökonomen Matthias Kalkuhl vom Berliner MCC-Klimainstitut läuft die Koalition derzeit finanz- wie klimapolitisch in eine falsche Richtung. Der CO₂-Preis sei zu niedrig und entfalte zu wenig Lenkungswirkung, gleichzeitig habe die Ampel zahlreiche Förderprogramme ins Leben gerufen. Zu deren Finanzierung reichen laut Kalkuhl „die Einnahmen aus dem KTF aber hinten und vorne nicht aus“.
Die Politik müsse eine grundsätzlich andere Richtung einschlagen, fordert der Ökonom: höherer CO₂-Preis, weniger Förderprogramme. „Das wäre unterm Strich günstiger und die Klimawirkung wäre höher“, so Kalkuhls Einschätzung.
Großer Fonds mit geringer Wirkung?: Mega-Nebenhaushalt als Wollmilchsau
Die Ampel hat den sogenannten Klima- und Transformationsfonds als wichtiges Finanzierungsinstrument ausgestaltet. Aber ist er wirklich gut aufgestellt? Oder gibt es Risiken?
Die Ampel mag sich nach außen über einen Sparhaushalt streiten. Aber nebenbei hat sie sich richtig viel Geld zur Seite gelegt. Denn neben dem Bundeshaushalt führt sie ihre Sondervermögen, auch Nebenhaushalte genannt. Der für die Bundeswehr ist recht bekannt – und einfach zu verstehen, weil präzise definiert: Es geht um die Finanzierung großer Wehrausgaben über mehrere Jahre, 100 Milliarden Euro liegen in dem Fonds.
Der KTF ist weniger bekannt. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Klima- und Transformationsfonds. Der war schon 2011 eingerichtet worden, damals noch als Energie- und Klimafonds (EKF), um Ausgabenprogramme in diesem Bereich zu bündeln. Er hatte lange ein eher überschaubares Volumen.
Die Ampel jedoch hat daraus ein großes Ding gemacht und den umgetauften Fonds mit erheblich mehr Mitteln ausgestattet – aber auch sehr vielen Aufgaben. 60 Milliarden Euro auf einen Schlag gab es gleich bei Amtsantritt im Dezember 2021 über die Weiterbuchung von nicht genutzten Kreditermächtigungen für Corona-Programme aus Groko-Zeiten.
Mehr als 100 Milliarden Euro können derzeit über den KTF bewegt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen bis ins Jahr 2024 summieren sich auf 128 Milliarden Euro. Wobei die tatsächlichen Ausgaben sich nach dem aktuellen Wirtschaftsplan für 2023 auf etwa 36 Milliarden Euro belaufen sollen. Das „Ist“ im Jahr davor betrug 28 Milliarden.
Was die Ampel für 2024 konkret plant, ist noch unklar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) arbeitet derzeit am neuen Wirtschaftsplan, der in den nächsten drei Wochen fertiggestellt werden soll.
Neuerdings wird der Nebenetat zu einer Art eierlegenden Wollmilchsau der Koalition umfunktioniert, da er immer mehr Zwecken dienen soll. Weiterhin sind zwar Ausgaben für Klimapolitik im Mittelpunkt, aber die Umwidmung mit dem Begriff „Transformation“ erweitert den Spielraum. Als sich die Regierung unlängst darauf verständigte, der Bahn 45 Milliarden Euro für Investitionen zu geben, wurden 15 Milliarden davon über einen Zeitraum von zwei Jahren im KTF gebucht – im regulären Etat war das Geld nicht aufzubringen.
Milliarden für Intel
Und als sich die Ampel entschloss, dem US-Halbleiterriesen Intel für sein Magdeburger Werk noch einen Schluck mehr an Subventionen zu gönnen, wurde das als Transformationsausgabe deklariert und ein Posten von drei Milliarden Euro im KTF eingerichtet. Plus etwa vier Milliarden für die weitere Förderung von Mikroelektronik.
„Die Halbleiterproduktion hat eine hohe Relevanz für klimaneutrale Technologien und ist damit für eine erfolgreiche Transformation der deutschen Wirtschaft hin zur Klimaneutralität von großer Bedeutung“, heißt es im Etatentwurf 2024 zur Begründung. In jedem Fall macht das in den Einzeletats, vor allem im Wirtschaftsministerium, Mittel frei für andere Zwecke.
Förderung für Heizungsumbau
Auch die Förderung für neue Heizungen in privaten Häusern, unlängst mit dem Gebäudeenergiegesetz beschlossen, soll über den KTF laufen. Von zehn Milliarden Euro ist zum Auftakt die Rede. Hier allerdings knüpft die Ampel an bisherigen Maßnahmen mit derselben Stoßrichtung an: die energetische Gebäudesanierung vor allem und die Verbesserung der Energieeffizienz.
Weitere Schwerpunkte sind der Ausbau der E-Mobilität samt Ladeinfrastruktur, der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und die Förderung erneuerbarer Energien. Entsprechend groß ist die Programmvielfalt im KTF mittlerweile. Bisher aber wurde mehr gekleckert als geklotzt.
Dabei ist der Nebenhaushalt nicht nur ein Vehikel, das mit sehr viel Geld und sehr vielen Fördermaßnahmen ausgestattet ist. Es steckte von Beginn an auch viel Luft in dem großen Beutel. Bei mehreren Programmen war die Nachfrage nämlich oft geringer als das Angebot. Mittel flossen daher nicht ab, sondern quasi in die Rücklage, die weitgehend aus Kreditermächtigungen besteht. Dass Habeck unlängst andeutete, es gebe Mittel für die Heizungsförderung via KTF, hängt damit zusammen.
Kaufprämie oder Infrastruktur?
Wie effizient diese Programme sind, ist umstritten. Beispiel E-Autos: Die über EKF und KTF finanzierte Kaufprämie für E-Autos war eher ein Mitnahmeeffekt beim Erwerb teurer Wagen als eine Anschubfinanzierung für eine E-Wende am Automarkt. Die parallele Förderung der Ladeinfrastruktur hatte nicht den Effekt, ein dichteres Netz auf den Weg zu bringen. Sie wird nun erhöht, die Kaufprämie dagegen läuft aus – eine Reaktion auf eine verfehlte Förderpolitik in den vergangenen Jahren.
Finanziert wird der KTF zu einem Teil über laufende Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung (Soll 2023: 8,6 Milliarden Euro) und Erlösen aus dem EU-Emissionshandel (7,3 Milliarden). Aber der Großteil des KTF-Volumens stammt weiterhin aus der 60-Milliarden-Transaktion. Gegen die hat die Unionsfraktion im Bundestag vor dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Die mündliche Verhandlung war im Juni, eine Entscheidung dürfte im Herbst fallen.
Sollten die Richter das Vorgehen der Ampel als verfassungswidrig einstufen, hätte die Koalition ein massives Geldproblem im KTF. Nach dem Wirtschaftsplan 2023 ist nur knapp die Hälfte der Ausgaben durch Einnahmen aus dem Emissionshandel und dem CO₂-Preis gedeckt.
Entscheidung aus Karlsruhe
Sollten die Richter gnädig sein, könnte es auch auf eine Entscheidung hinauslaufen, die dem KTF strikte Beschränkungen auferlegt. Ähnlich wie das Sondervermögen Bundeswehr und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem die Energiepreisbremsen finanziert werden, müsste die Ampel dann auch den KTF gesetzlich weniger flexibel ausgestalten.
Um dem KTF mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, plant die Ampel, den CO₂-Preis ab dem nächsten Jahr wieder zu erhöhen. Wie hoch der Preis dann aber tatsächlich ausfällt, hat sie noch nicht entschieden. Dies sei „Gegenstand von Beratungen“, heißt es im Bundesfinanzministerium.
Die Regierung hatte wegen der hohen Energiepreise die eigentlich vorgesehene Erhöhung des CO₂-Preises im nationalen Emissionshandel ausgesetzt. Ginge sie auf den ursprünglichen Preispfad zurück, würde der Preis ab 2024 bei 45 Euro pro Tonne liegen. Das würde Mehreinnahmen in Höhe von rund 12 Milliarden Euro in den KTF spülen. Bei 35 Euro lägen die Mehreinnahmen rund 2,6 Milliarden Euro niedriger.
Nach Ansicht des Klimaökonomen Matthias Kalkuhl vom Berliner MCC-Klimainstitut läuft die Koalition derzeit finanz- wie klimapolitisch in eine falsche Richtung. Der CO₂-Preis sei zu niedrig und entfalte zu wenig Lenkungswirkung, gleichzeitig habe die Ampel zahlreiche Förderprogramme ins Leben gerufen. Zu deren Finanzierung reichen laut Kalkuhl „die Einnahmen aus dem KTF aber hinten und vorne nicht aus“.
Die Politik müsse eine grundsätzlich andere Richtung einschlagen, fordert der Ökonom: höherer CO₂-Preis, weniger Förderprogramme. „Das wäre unterm Strich günstiger und die Klimawirkung wäre höher“, so Kalkuhls Einschätzung.